(B 1) Enmannsche Kaisergeschichte
Einleitung
I. Vorbemerkung
Die Breviarien des vierten Jahrhunderts bieten eine Kette von Kaiserbiographien, die inhaltlich immer wieder auffällige Übereinstimmungen zeigen. Dass hier eine gemeinsame Grundquelle vorliegt, hat der Petersburger Bibliothekar Alexander Enmann in einer 1883 publizierten Untersuchung nachweisen können1. Diese Quelle wird daher nach ihrem Entdecker allgemein als „Enmannsche Kaisergeschichte“ (im folgenden EKG) bezeichnet2. Nachdem insbesondere in den 70er Jahren des vorigen Jahrhunderts große Bedenken gegen die Rekonstruktionen Enmanns herrschten, dominieren in der gegenwärtigen Diskussion eher die Befürworter von deren Tragfähigkeit3. Allerdings werden auch immer wieder Stimmen laut, die die EKG weiterhin für ein Phantom und für das Produkt purer Phantasie halten4.
S. 4Die Berücksichtigung von zwar verloren gegangenen, aber durch die Gegenüberstellung ähnlicher Zeugnisse rekonstruierbaren Werken ist in Editionsunternehmen durchaus Praxis. Erinnert sei an den von Bidez rekonstruierten homöischen Autor im Anhang VII seiner Philostorgiosausgabe5 oder aber an die Rekonstruktion der Consularia Italica („Ravennater Annalen“) durch Mommsen im ersten Band der Chronica Minora, ferner an Theophilos von Edessa bzw. die östliche Quelle des Theophanes6. Gerade weil das Unternehmen „Kleine und fragmentarische Historiker der Spätantike“ keine herkömmliche Fragmentsammlung ist, sieht der Editionsplan die Aufnahme rekonstruierter Werke in Ausnahmefällen vor7. Ein solches Unterfangen hat allerdings immer nur heuristischen Wert. Wenn die Stücke eines solchen verloren gegangenen Werks zusammengestellt und dokumentiert werden, geht es um Plausibilisierung, Untersuchung und Diskussion, nicht um einen abschließenden Beweis. Das gilt selbst dann, wenn im Rahmen dieser Untersuchung bestimmte Inhalte der EKG wegen Bindefehler der Textzeugen für „sicher“ gehalten werden. Der Kontrast zwischen dieser Rekonstruktion und der Arbeit an namentlich bekannten fragmentarischen Historikern sollte gleichwohl nicht überbetont werden. Auch das Fragment in einer SammlungS. 5 wie derjenigen Jacobys ist immer das Resultat einer komplexen gedanklichen Operation, deren Ausgang Unwägbarkeiten unterworfen bleibt. Eine scharfe Grenze zwischen Fragmenten, die durch Zitate bekannt sind, und Fragmenten, die erst durch quellenkritische Operationen isoliert werden, gibt es nicht8. Dementsprechend mag es erlaubt sein, die hier zusammengestellten Parallelen, die in ihrer Zusammenschau Inhalte der rekonstruierten Quelle erkennen lassen, cum grano salis als „Fragmente“ der EKG zusammenzustellen und mit Nummern zu versehen9. Diese Fixierung soll vor allem für die künftigen Diskussionen um die EKG eine Verständigungsbasis schaffen.
Wenn trotz aller Schwierigkeiten und offenen Fragen, die mit einem solchen Versuch verbunden sein müssen, die Aufnahme einer Ausgabe der EKG-Stücke in das Projekt KFHist gewagt wird, rechtfertigt sich dies vor allem dadurch, dass diese nicht isoliert vorgelegt wird. Vielmehr erscheint sie komplementär zur Edition von Autoren, die aus der EKG geschöpft haben, also von Aurelius Victor, Eutrop und Rufius Festus (KFHist B 2, 3, 4). Der gewissermaßen als Prolegomenon zu diesen Ausgaben gebotene Rekonstruktionsversuch bietet dabei den Vorteil, dass die Verbindungen der genannten Werke zur EKG nicht jedes Mal separat erläutert werden müssen. Die Darlegung der Parallelen erlaubt eine Vorstellung davon zu gewinnen, wo diese Werke eng auf die EKG rekurrieren und wo sie ein selbständiges Profil haben. Letzteres ist vor allem für Aurelius Victor der Fall, der zwar immer wieder der EKG folgt, aber in großem Umfang auch andere Traditionen benutzt hat und auch mit dem Material der EKG sehr selbständig umgeht.
Neben den drei genannten Autoren schöpften auch andere Werke aus der EKG und sind daher in der Rekonstruktion zusätzlich zu berücksichtigen. Die Epitome de Caesaribus, die zwar bisweilen direkt die EKG benutzt, daneben aber Aurelius Victor, Eutrop und viele andere Traditionen kennt, findet sich zwar ebenfalls im Editionsplan der KFHist, ist aber im Modul D des Projektes eingeordnet (KFHist D 3). Weitere Werke, für die die Benutzung der EKG angenommen worden ist und die hinzuzuziehen waren, sind die S. 6Chronik des Hieronymus und die Historia Augusta. Für beide Werke wurden eine Neuedition im Rahmen des Projekts, das nur „kleine“ Historiker in Text und in deutscher Übersetzung für den akademischen Unterricht zugänglich machen soll, nicht vorgenommen. Die in der Zusammenstellung der Textzeugen übernommenen Stücke entstammen den Editionen von Helm und Hohl bzw. den Einzelbänden der Budé-Ausgabe10.
Die gehaltvolle Studie von Enmann ist auch heute gut lesbar und kann als Muster methodischer Umsicht gelten, was Ziele und Möglichkeiten von Quellenuntersuchungen betrifft11. Die Beobachtungen Enmanns bleiben im Großen und Ganzen gültig. Eine Modifikation ist lediglich dahingehend notwendig, dass Enmann wegen der Übereinstimmungen zwischen seiner Kaisergeschichte und der – vorgeblich in diokletianisch-konstantinischer Zeit verfassten – Historia Augusta noch angenommen hatte, dass die Kaisergeschichte mit der Epoche der Tetrarchie abschloss und dass dann eine Fortsetzung dieser Kaisergeschichte die Darstellung bis in die Zeit des Constantius II. fortführte. Durch die mit den Beobachtungen H. Dessaus begründete Spätdatierung der Historia Augusta ist diese Hilfskonstruktion nicht mehr notwendig12. Diese Spätdatierung bedeutet allerdings auch, dass ein Teil der Gemeinsamkeiten zwischen den Breviatoren und der Historia Augusta nicht mehr auf die Kaisergeschichte zurückgeführt werden muss und dass damit der Bestand an eindeutig der Kaisergeschichte zuzuweisenden Passagen schrumpft13.
Für den hier vorgenommenen Versuch der Rekonstruktion der EKG wird folgendes Verfahren gewählt. Statt nebeneinander liegender synoptischerS. 7 Spalten (wie etwa bei der Rekonstruktion der Consularia Italica durch Mommsen) sollen einzelne Abschnitte vorgestellt werden, in denen die Textzeugen nacheinander stets unter den gleichen Buchstaben aufgeführt werden. Zunächst werden Passagen aus Eutrop und den mit ihm nah verwandten Autoren Hieronymus und Festus vorgestellt, dann wird Aurelius Victor hinzugezogen, der als eigenwilliger Stilist seine Vorlage in besonders hohem Maße verändert haben dürfte, anschließend die Epitome de Caesaribus sowie die Historia Augusta und übrige Zeugen. Die Reihenfolge ist damit: a) Eutrop, b) Hieronymus, c) Rufius Festus, d) Aurelius Victor, e) Epitome de Caesaribus, f) Historia Augusta, g) weitere Zeugen (z. B. Ammianus Marcellinus, Polemius Silvius, Origo Constantini = Anonymus Valesianus I, Synkellos). Die Zusammenstellung und Auswahl ergab sich aus dem eigenen Vergleich der Texte, aber auch der Konsultation der einschlägigen, seit Enmann vorgelegten Arbeiten zur Kaisergeschichte14. Was den Zuschnitt der so hergestellten jeweiligen „Fragmente“ betrifft, besteht kein strenges System, sondern wurden ähnlich wie bei der Einteilung von Paragraphen nach Sinnabschnitten verfahren. Das gelingt in den Fällen nur eingeschränkt, in denen in den aus der EKG schöpfenden Quellen mehrere Nachrichten miteinander kombiniert werden und in denen gerade in der identischen Kombination eine gemeinsame Grundquelle durchscheint.
Der Kommentar bietet einen knappen Verweis auf die zu konstatierenden Gemeinsamkeiten, wobei gegebenenfalls auch Notizen zu den einzelnen Zeugen hinzugefügt werden. Er bietet eine deutsche Übersetzung aller Passagen, die nicht an anderer Stelle im Projekt KFHist zu finden sind, also vor allem des Hieronymus, der Historia Augusta (meist im Anschluss an Hohl), sowie weiterer Autoren wie Ammianus Marcellinus oder Synkellos.
II. Zum Verhältnis der Textzeugen: Aurelius Victor und Eutrop
Zum Verhältnis dieser Zeugen untereinander sind einige Bemerkungen vorauszuschicken. Zwingend sind der EKG alle Passagen zuzuweisen, in denen der um 360 schreibende Aurelius Victor (d) und der um 370 schreibende Eutrop (a) übereinstimmen. Solche Fälle sind vor allem dann ein HinweisS. 8 auf eine gemeinsame Provenienz, wenn sie einen gemeinsamen Fehler enthalten15.
Eine besondere Zusammenballung solcher Bindefehler fällt bekanntlich für die Regierungszeit des Septimius Severus auf16. Zu nennen sind etwa17:
Eutr. 8,18,4: Pescennium Nigrum, qui in Aegypto et Syria rebellaverat, apud Cyzicum interfecit. … sub eo etiam Clodius Albinus, qui in occidendo Pertinace socius fuerat Iuliano, Caesarem se in Gallia fecit victusque apud Lugdunum et interfectus.
Aur. Vict. 20,8 f.: Pescennium Nigrum apud Cyzicenos, Clodium Albinum Lugduni victos coegit mori. quorum prior Aegyptum dux obtinens18 bellum moverat spe dominationis, alter, Pertinacis auctor occidendi, … in Gallia invaserat imperium.
Pescennius Niger wurde in Wirklichkeit zwar in der Nähe von Kyzikos militärisch geschlagen. Er erlitt aber weitere Niederlagen bei Nikaia und Issos und wurde schließlich bei Antiocheia getötet19.
Ebenso irrig ist die gemeinsame Angabe des Eutrop und des Aurelius Victor, Clodius Albinus habe sich mit Didius Iulianus bei der Ermordung des Pertinax verbündet:
Eutr. 8,16: octogesimo die imperii praetorianorum militum seditione et Iuliani scelere occisus est; 8,18,4: sub eo etiam Clodius Albinus, qui in occidendo Pertinace socius fuerat Iuliano.
S. 9Aur. Vict. 18,2: eum milites … impulsore Didio foede iugulavere octagesimo imperii die. 20,8 f.: Clodium Albinum … Pertinacis auctor occidendi.20
Und schließlich berichten beide Quellen über einen Bürgerkriegssieg des Septimius Severus gegen Didius (‚Salvius‘) Iulianus an der Milvischen Brücke, der als freie Erfindung gelten muss und anscheinend eine Rückprojektion der Ereignisse von 312 ist21:
Eutr. 8,16: Pertinax … militum seditione et Iuliani scelere occisus est. 8,17: Salvius Iulianus rem publicam invasit, vir nobilis et iure peritissimus, nepos Salvii Iuliani qui sub divo Hadriano perpetuum composuit edictum. victus est a Severo apud Mulvium pontem, interfectus in palatio.
Aur. Vict. 19,4: imperator creatus pontem proxime Mulvium acie devicit. missique, qui fugientem insequerentur, apud palatium Romae obtruncavere.
Für die Zeit des Caracalla ist auf die falsche Angabe sowohl Eutrops als auch des Aurelius Victor zu verweisen, Julia Domna sei lediglich die Stiefmutter des jungen Kaisers gewesen22. Die ebenfalls von beiden Quellen gemeinsam geäußerte Behauptung, Theodora, die Gattin des Constantius I., sei nur die Stieftochter des Maximianus Herculius gewesen, gerät dadurch in ein gewisses Zwielicht. Sie findet sich im Zusammenhang mit der Angabe über die Hochzeit des Constantius (bei der Schaffung der Tetrarchie 293), wo die Parallelität der Wendungen und Ausführungen nur durch den evidenten stilistischen Gestaltungswillen des Aurelius Victor ein wenig verschleiert wird. Aurelius Victor weiß dann zusätzlich aufgrund seiner historischen Bildung davon zu berichten, dass die befohlene Scheidung der tetrarchischen Caesares von ihren früheren Gattinnen der bekannten Parallele des Falls des Tiberius entspricht, der sich auf Befehl des Augustus von Vipsania trennen musste23.
Eutr. 9,22,1: atque ut eos etiam (1.) adfinitate coniungeret, Constantius privignam Herculii Theodoram accepit, ex qua postea sex liberos, Constantini fratres, habuit, Galerius (2.) filiam Diocletiani Valeriam, (3.) ambo uxores, quas habuerant, repudiare conpulsi.
Aur. Vict. 39,24 f.: his de causis Iulium Constantium, Galerium Maximianum, cui cognomen Armentario erat, creatos Caesares (1.) in affinitatem vocant. prior Herculii privignam, alter (2.) Diocletiano editam sortiuntur S. 10(3.) diremptis prioribus coniugiis, ut in Nerone Tiberio ac Iulia filia Augustus quondam fecerat.
Weitere Beispiele von Bindefehlern, aber auch von sehr spezifischen Übereinstimmungen lassen sich für die Geschichte der Reichskrise aufführen. Hinzuweisen ist etwa auf die Behauptung, Maximinus Thrax sei im Kampf von Pupienus getötet worden24, oder auf die Darstellung der Anfänge des Kriegs Gordians III. gegen die Perser, mit der Öffnung des Janustempels und den großen Siegen, sowie der anschließenden Ermordung des jungen Kaisers durch den praefectus praetorio Philippus Arabs (Eutr. 9,2,2 f.; Aur. Vict. 27,7 f.)25. Ferner ist auf die Parallele von Eutr. 9,22,2 und Aur. Vict. 39,39–41 hinzuweisen, nämlich in der Erzählung über einen angeblichen Friedensschluss des Usurpators Carausius mit den Tetrarchen, die Beseitigung des Carausius durch seinen Gefährten Allectus und den Sieg des Prätorianerpräfekten Asclepiodotus über Allectus26. Für die Geschichte des frühen vierten Jahrhunderts kann auf die in beiden Quellen auffallende irrige Nachricht, Severus sei in Ravenna getötet worden, hingewiesen werden27. Nur Aurelius Victor und Eutrop berichten schließlich über den angeblichen Kometen, der den Tod Konstantins ankündigte28.
Diese unbestreitbaren und sehr spezifischen Parallelen können nur auf eine gemeinsame Quelle zurückgeführt werden. Möglich wäre als Alternativerklärung allenfalls, dass Eutrop den Aurelius Victor ausgeschrieben hat29. Wie unwahrscheinlich diese Annahme aber ist, kann an dem gerade diskutierten Fall der Geschichte der britannischen Usurpation gezeigt werden.
Eutr. 9,22,2 bietet: cum Carausio tamen, cum bella frustra temptata essent contra virum rei militaris peritissimum, ad postremum pax convenit. eum post septennium Allectus socius eius occidit atque ipse post eum Britannias triennio tenuit. qui ductu Asclepiodoti praefecti praetorio oppressus est. ita Britanniae decimo anno receptae.
Aur. Vict. 39,39–42: solique Carausio remissum insulae imperium, postquam iussis ac munimento incolarum contra gentes bellicosas opportunior habitus. quem sane sexennio post Allectus nomine dolo circumvenit. qui cum S. 11eius permissu summae rei praeesset, flagitiorum et ob ea mortis formidine per scelus imperium extorserat. quo usum brevi Constantius Asclepiodoto, qui praetorianis praefectus praeerat, cum parte classis ac legionum praemisso delevit.
Ganz offenkundig berichtete die Grundquelle in einer sehr detaillierten Chronologie über den Gang des britannischen Sonderreichs. Drei dieser Daten sind bei Eutrop festgehalten worden, nämlich die sieben Jahre der Regierung des Carausius, die dreijährige Regierungszeit des Allectus und die Rückführung Britanniens unter die Herrschaft der Tetrarchen im zehnten Jahr30. Aurelius Victor hat dagegen nur die Angabe, dass Allectus nach einem Sexennium die Herrschaft übernahm, trägt also nur einen Teil aus den gemeinsamen Quelleninformationen vor. Umgekehrt berichtet er aber Näheres zu den Hintergründen der Tötung des Carausius durch Allectus. Beide Quellen ergänzen sich anscheinend auch, was den Kompromiss zwischen Carausius und der Tetrarchie betrifft, indem Eutrop die Tatsache des Friedensschlusses, Aurelius Victor dagegen den Inhalt (Überlassung der Herrschaft über Britannien) bezeugt. Dieser angebliche Friedensschluss ist im Übrigen wieder eine Art Bindefehler, da nach Ausweis der Münzen Carausius niemals die Anerkennung der Tetrarchie fand, was diesen nicht daran hinderte, sich umgekehrt als „Bruder“ der Tetrarchen zu bezeichnen31. Generell lässt sich gegen eine Benutzung des Victor durch Eutrop anführen, dass Aurelius Victor bisweilen zur Unkenntlichkeit verkürzte und unvollständige Versionen bietet und Eutrop seine Informationen kaum aus diesen Versionen ziehen konnte32.
In der Zusammenstellung der Stellen, die Eutrop und Aurelius Victor aus der gemeinsamen Quelle bezogen haben, werden wegen des Ökonomieprinzips keine Stücke aufgenommen, in denen nur einer der beiden Autoren berichtet oder für die keine größeren inhaltlichen Überschneidungen erkennbar sind. Ein Beispiel für diese Konstellation stellt etwa die Darstellung des Endes des Gallienus in beiden Quellen dar. Eutr. 9,11,1 weiß hier nur, dass Gallienus gemeinsam mit seinem Bruder Valerian umgebracht wurde, nennt aber keine sonstigen Details. Dagegen fehlt bei Aurelius Victor (33,18–31) gerade die Angabe über die Tötung des Bruders des Gallienus, auch wenn er ansonsten einen überaus ausführlichen Bericht über das Komplott gegenS. 12 Gallienus bei der Belagerung des Aureolus in Mailand bietet. Man kann zwar annehmen, dass beide Berichte auf ein und dieselbe gemeinsame Grundquelle zurückgehen und für die Rekonstruktion dieser Quelle dann die Elemente des einen Berichts mit denen des anderen zusammengefügt werden33. Die Annahme bleibt aber hypothetisch und setzt auch voraus, dass Aurelius Victor für seine komplex gestaltete Erzählung zur Geschichte der Reichskrise lediglich eine einzige Quelle benutzt hat. Gerade dies ist aber keineswegs sicher. Berücksichtigt werden daher für die Rekonstruktion der EKG nur Passagen, in denen Aurelius Victor und Eutrop manifest im gleichen eng gefassten Kontext berichten.
III. Weitere Textzeugen
Die Übereinstimmungen zwischen Aurelius Victor und Eutrop definieren also die EKG und bilden das Gerüst ihrer Rekonstruktion. Zusätzliches Material zur EKG findet sich in anderen Textzeugen. Allerdings kann dieses Material nur unter Einschränkungen und unter Berücksichtigung zahlreicher spezifischer Problemlagen hinzugezogen werden. Man hat es somit bei der EKG mit einer rekonstruierten Quelle zu tun, deren Existenz zwar unbestreitbar ist, die aber jenseits eines klar zu definierenden Kerns bisweilen nur approximativ bestimmt werden kann. Diese Unschärfen hängen damit zusammen, dass sich für das Verhältnis einiger wichtiger Quellen untereinander oft mehrere Erklärungsmöglichkeiten ergeben. Einige Fallkonstellationen werden hier im Zusammenhang mit der Vorstellung zusätzlicher Textzeugen diskutiert.
1. Historia Augusta
Ein klassisches Problem der Forschung zur EKG stellt das Verhältnis zwischen der Historia Augusta einerseits und den spätantiken Breviatoren Eutrop und Aurelius Victor andererseits dar. Der Autor der sogenannten Historia Augusta, einer Sammlung von Kaiserbiographien mit fiktiven Elementen, dürfte nach der Mehrheitsmeinung um die Wende vom vierten zum fünften Jahrhundert geschrieben haben. In der Historia Augusta sind nun S. 13zahlreiche Stellen zu erkennen, die wörtlich bald Aurelius Victor, bald Eutrop gleichen, etwa in der Severusbiographie34, in den Ausführungen zu den gallischen Gegenkaisern oder zur Vita Mark Aurels35. Solche Passagen können zwar auf eine gemeinsame Quelle zurückgeführt werden, sie lassen sich aber aufgrund der späten zeitlichen Einordnung der Historia Augusta auch dadurch erklären, dass der Autor der Historia Augusta Eutrop oder Aurelius Victor konsultiert hat. Bereits Enmann hatte hier Verdacht geschöpft, auch wenn er diesen Verdacht dann aufgrund des vermeintlichen Entstehungsdatums der Vitensammlung in tetrarchisch-konstantinischer Zeit ausschließen musste36. Im Zusammenhang mit den jüngeren Debatten um die Datierung der Historia Augusta haben diese Fragen erneut Bedeutung erlangt. Lippold hat, entsprechend seiner Ablehnung der Entdeckung Dessaus und der Rückkehr zur Frühdatierung der Historia Augusta, alle Stücke, in denen die Historia Augusta Aurelius Victor oder Eutrop ähnelt, der gemeinsamen Quelle dieser Autoren zugewiesen37. Dagegen erklären Chastagnol und andere diese Übereinstimmungen vorzugsweise damit, dass der Verfasser der Historia Augusta die Breviatoren direkt benutzt hat38.
S. 14Als Beispiel für die Art der Beziehungen zwischen der Historia Augusta, der Kaisergeschichte und den aus ihr schöpfenden Breviatoren mag die Geschichte des Triumphs Aurelians über Tetricus und Zenobia dienen39. Die Kaisergeschichte beschrieb ursprünglich, wie die Gemeinsamkeiten zwischen Victor und Eutrop hier eindeutig belegen können, (1.) die Kapitulation des Tetricus, der sich vor seiner eigenen Armee fürchtete und sie daher preisgab, ferner (2.) dessen Zurschaustellung im Triumph Aurelians sowie (3.) die anschließende Begnadigung und die Erhebung zum corrector Lucaniae. Aurelius Victor hat im Unterschied zu Eutrop bei der Darstellung dieses Triumphs Aurelians die ebenfalls besiegte Zenobia, die neben Tetricus einhergeführt wurde (4.), nicht genannt. Dafür erwähnt er (5.) die von Eutrop ignorierte Usurpation des Faustinus, die Tetricus zur Kapitulation veranlasste, sowie (6.) die Existenz eines Sohnes des Tetricus, der ebenfalls begnadigt und geehrt wird:
Eutr. 9,13: post eum Aurelianus suscepit imperium, … . superavit in Gallia Tetricum apud Catalaunos (1.) ipso Tetrico prodente exercitum suum, cuius adsiduas seditiones ferre non poterat;quin etiam per litteras occultas Aurelianum ita fuerat deprecatus, ut inter alia versu Vergiliano uteretur: “Eripe me his invicte, malis”. Zenobiam quoque, quae occiso Odenatho marito Orientem tenebat, haud longe ab Antiochia sine gravi proelio cepit, (2.) ingressusque Romam nobilem triumphum quasi receptor Orientis Occidentisque egit praecedentibus currum Tetrico (4.) et Zenobia. (3.) qui quidem Tetricus corrector Lucaniae postea fuit ac privatus diutissime vixit; Zenobia autem posteros, qui adhuc manent, Romae reliquit.40
Aur. Vict. 35,3–5: Tetrici … caesae legiones (1.) proditore ipso duce. namque Tetricus, cum (5.) Faustini praesidis dolo corruptis militibus plerumque peteretur, (1.) Aureliani per litteras praesidium imploraverat eique adventanti producta ad speciem acie inter pugnam se dedit. ita, uti rectore nullo solet, turbati ordines oppressi sunt, (2.) ipse post celsum biennii imperium in triumphum ductus (3.) Lucaniae correcturam (6.) filioque veniam atque honorem senatorum cooptavit.
S. 15Die Historia Augusta bietet in der Vita Aureliani eben diese Erzählung von der Preisgabe des eigenen Heers durch Tetricus, ferner vom Triumph über Zenobia und Tetricus und von der Erhebung des Tetricus zum corrector Lucaniae:
Hist. Aug. Aurelian. 32,3 f.: (Aurelianus) … Occidentem petit atque, ipso Tetrico exercitum suum prodente quod eius scelera ferre non posset, deditas sibi legiones obtinuit. princeps igitur totius orbis Aurelianus, pacatis Oriente, Gallis atque undique terris,Romam iter flexit, ut de Zenobia et Tetrico, hoc est de Oriente et de Occidente, triumphum Romanis oculis exhiberet.
Hist. Aug. Aurelian. 39,1: Tetricum triumphatum correctorem Lucaniae fecit, filio eius in senatu manente.
In der Vita des Tetricus wiederholt die Historia Augusta diese Geschichte. Zahlreiche Elemente werden genannt, die sich bei Eutrop finden, nämlich etwa den von Tetricus zitierten Vergilvers oder die Darstellung des Triumphs über Zenobia und Tetricus als eines Triumphs über den Orient und Okzident (s. fettgedruckte Stellen in den Zitaten oben und unten). Einige Angaben Eutrops, die in der Vita Aureliani noch korrekt wiedergegeben worden sind, werden in dieser Nebenvita scherzhaft erweitert. Aus dem corrector Lucaniae wird der corrector totius Italiae und es folgt ein Verzeichnis der spätantiken Kleinprovinzen Italiens. Die Tetricus-Vita bietet weiter den bei Eutrop wiedergegebenen Vergilvers, der in der Aurelian-Vita noch nicht vorkommt. Während bei Eutrop Tetricus als corrector Lucaniae im spätantiken Sinne Privatmann (= Nicht-Kaiser) ist, überhöht die Historia Augusta, dieses Detail aufgreifend und mit ihm spielend, den Tetricus zum Nicht-Privatmann, nämlich zum collega des Aurelian und sogar zum imperator:
Hist. Aug. trig. tyr. 24,2–5: et cum multa Tetricus feliciterque gessisset et diuque imperasset, ab Aureliano victus, cum militum suorum inpudentiam et procacitatem ferre non posset, volens se gravissimo principi et severissimo dedit. versus denique illius fertur, quem statim ad Aurelianum scripserat: ‚eripe me his, invicte, malis‘. quare … senatorem populi Romani eundemque consularem, qui iure praesidiali omnes Gallias rexerat, per triumphum duxit, eodem tempore quo et Zenobiam …. pudore tamen victus, vir nimium severus eum, quem triumphauerat, correctorem totius Italiae fecit, id est Campaniae, Samni, Lucaniae Brittiorum, Apuliae Calabriae, Etruriae atque Umbriae, Piceni et Flaminiae omnisque annonariae regionis, ac Tetricum non solum vivere, sed etiam in summa dignitate manere passus est,S. 16 cum illum saepe collegam, nonnumquam commilitonem, aliquando etiam imperatorem appellaret.
Hist. Aug. trig. tyr. 25,2: qui (der jüngere Tetricus) et ipse cum patre per triumphum ductus, postea omnibus senatoriis honoribus functus est.
Man könnte also hier der Auffassung sein, dass die Historia Augusta alle ihre Inhalte über den Triumph Aurelians und über das Los des Tetricus aus Eutrop gewinnen konnte. Dafür sprechen die wörtlichen Übereinstimmungen. Allerdings weiß, wie gerade gezeigt worden ist, nur Aurelius Victor etwas über einen Sohn des Tetricus. Die Historia Augusta hat daher entweder Aurelius Victor und Eutrop gleichermaßen benutzt und deren Angaben miteinander verbunden, oder sie hat die Grundquelle der beiden Autoren gekannt, nämlich die EKG.
Möglich ist allerdings die Erklärung, dass man gar nicht von einer Alternative auszugehen hat, sondern dass die Historia Augusta sowohl die EKG als auch Aurelius Victor und Eutrop benutzt hat. Das Phänomen, dass neben der Grundquelle auch spätere Bearbeitungen hinzugezogen werden, ist keineswegs vereinzelt und entspricht etwa dem Umstand, dass Zonaras neben Cassius Dio auch die Zusammenfassung des Cassius Dio in der Epitome des Xiphilinos kannte. Diese Ungewissheit, die durch die gleichzeitige Benutzung der Grundquelle und der abgeleiteten Quellen erzeugt wird, erschwert es in diesem Fall, zu einer entschiedeneren Aussage zu kommen.
Die mit Eutrop und Aurelius Victor übereinstimmenden Passagen der Historia Augusta sind wegen dieser Ungewissheiten hier großenteils dokumentiert41. Denn zumindest in einigen Fällen kann eine von Victor und Eutrop unabhängige Benutzung der EKG wahrscheinlich gemacht werden42. S. 17Diese Eventualität gilt auch für die Passagen, in denen die Historia Augusta für die Viten des Septimius Severus oder des Caracalla beinahe wortwörtlich mit Aurelius Victor und für die Vita des Mark Aurel fast wörtlich mit Eutrop übereinstimmt. Denn selbst für einen auf den ersten Blick ziemlich klaren Fall (Aur. Vict. 20,25 f. und Hist. Aug. Sept. Sev. 18,9 f.43) hat Dessau44, der die Benutzung von Aurelius Victor durch die Historia Augusta als Kriterium für die von ihm entdeckte Spätdatierung benannt hat, als Konzession die Möglichkeit in Erwägung gezogen, dass die Historia Augusta nicht Aurelius Victor, sondern einen von diesem nicht weiter veränderten Bericht benutzt haben könnte45. Zu konzedieren ist, dass durch die Aufnahme der Fälle, in denen die Ähnlichkeiten zwischen der Historia Augusta und den Breviarien im Sinne Chastagnols und anderer schlicht durch die Benutzung der Breviarien erklärt werden könnten, eine größere, mit dem Ökonomieprinzip widerstreitende Unschärfe in der Umgrenzung des EKG-Materials in Kauf genommen wird.
2. Epitome de Caesaribus
Für die Epitome de Caesaribus gibt es ausreichend Anhaltspunkte für die Annahme, dass insbesondere in den früheren Biographien Aurelius Victor, in den späteren Biographien vor allem Eutrop direkt benutzt worden ist46. In den Fällen wörtlicher Abhängigkeit der Epitome de Caesaribus von Aurelius Victor bzw. von Eutrop wird auf eine Wiedergabe der Passagen verzichtet47.
S. 18Nicht eingehend behandelt werden die komplizierten Fragen der genauen Quellenbeziehungen zwischen Aurelius Victor, Sueton und der Epitome de Caesaribus. Diese Diskussion erfolgt partiell im Kommentar zur Epitome de Caesaribus (KFHist D 3). Eine Gegenüberstellung von Aurelius Victor und der Epitome de Caesaribus zeigt, dass die Epitome vieles aus Aurelius Victor entnimmt, diesem oft aber entscheidende Informationen voraushat. Schlumberger geht nun davon aus, dass die Epitome de Caesaribus Suetonstoff gewissermaßen aus drei Ebenen geschöpft hat, zunächst direkt aus Aurelius Victor, dann aus der mit Eutrop gemeinsamen Quelle, nämlich dem von ihm mit der EKG identifizierten Suetonius auctus, den Cohn postuliert hatte48,, und schließlich aus einem Autor des vierten Jahrhunderts, der noch einmal selbständig Sueton benutzt und mit eigenen historiographischen Akzenten versehen hat49. Suetonstoff kann also – in ähnlicher Form wie Liviusstoff in den späten Traditionen von den Periochae bis zu Eutrop – über ganz verschiedene Wege vermittelt worden sein kann. Suetonische Passagen in der Epitome de Caesaribus sowie Übereinstimmungen der Epitome de Caesaribus mit Aurelius Victor werden daher nur mit großer Zurückhaltung für die Rekonstruktion der EKG hinzugezogen.
Auch für weitere zusätzliche Informationen, die in der Epitome de Caesaribus gegenüber Aurelius Victor für die Zeit nach Domitian auffallen, ist in der Regel nicht die Einwirkung der EKG anzunehmen50.
Zu diskutieren sind ferner die zahlreichen Übereinstimmungen, die sich zwischen der Historia Augusta und der Epitome de Caesaribus konstatieren lassen51. Diese Übereinstimmungen erklären sich durch die Benutzung einer S. 19Grundquelle, vielleicht die des Marius Maximus. Sie sind aus der Rekonstruktion der EKG auf jeden Fall auszuklammern52. Schwierig ist dagegen die Beurteilung der Fälle, in denen sich Übereinstimmungen nicht nur zwischen der Historia Augusta und der Epitome de Caesaribus aufzeigen lassen, sondern als weiterer Zeuge Eutrop hinzutritt. Einige Beispiele finden sich in der hier vorliegenden Zusammenstellung für Passagen aus der Geschichte der Adoptivkaiser und der Severer53. Für diese Fälle bietet Schlumberger die Erklärung an, dass alle drei Autoren Marius Maximus und nicht die EKG benutzt haben könnten. Für eine Benutzung des Marius Maximus bei Eutrop spreche in diesem Fall die Tatsache, dass Eutrop besonders lange und kohärente Passagen biete, wie etwa die Passagen über die Bewältigung des Markomannenkriegs und seiner finanziellen Folgen (Eutr. 8,12 f.)54.
Der Fall beleuchtet eine weitere mögliche Unschärfe bei der Bestimmung der EKG, wenn nämlich Zeugen, die für die Rekonstruktion einer verlorenen Quelle (EKG) hinzugezogen werden, auch für die Rekonstruktion einer weiteren, dahinterliegenden Quelle (Marius Maximus) zu dienen haben. Angesichts der vielfachen Schichtungen historiographischer Traditionen sind solche Überlegungen auf jeden Fall legitim und auch angebracht. Im konkreten Fall ist allerdings die hier zu beobachtende größere Ausführlichkeit Eutrops kein sicheres Kriterium für die Ermittlung dieser Quelle, da der Maßstabswechsel auch sonst für Eutrop typisch ist und offenkundig beS. 20reits die EKG charakterisierte. Ausführlichere Passagen finden sich bei Eutrop etwa für die Geschichte der Reichskrise oder für den Aufbau der Tetrarchie55. Ein Quellenwechsel scheint daher für die Geschichte Mark Aurels und der Markomannenkriege nicht zwingend gegeben. Möglich ist vielmehr, dass die EKG, die ja für die Kaiser der Julisch-Claudischen Dynastie Sueton benutzt hat, für die Kaiser des zweiten Jahrhunderts dessen Fortsetzer Marius Maximus benutzte. Die Historia Augusta und die Epitome hätten dann direkt auf Marius Maximus zurückgegriffen, Eutrop nur indirekt über die EKG. Der Fall illustriert allerdings, wo die Quellenforschung an ihre Grenzen stößt, wenn es nämlich darum geht, Aussagen über die Quelle einer verlorenen Quelle zu machen.
3. Hieronymus
a) Eutrop, Hieronymus und Festus: Unmittelbarer oder mittelbarer Rückgriff auf die EKG?
Einen weiteren Fall, für den hinsichtlich der Bestimmung des Gehalts der EKG das Ökonomieprinzip Anwendung finden muss, stellen die Übereinstimmungen zwischen Eutrop, Hieronymus und Festus dar. Zunächst sind natürlich alle Passagen auszuklammern, in denen es zwar inhaltliche Ähnlichkeiten zwischen Eutrop und Hieronymus gibt, Hieronymus aber aus der Chronik des Euseb geschöpft hat.
Zwei Beispiele genügen zur Illustration der Problematik:
In Eutr. 7,22,2 heißt es: senatus obitu ipsius circa vesperam nuntiato nocte inrupit in curiam et tantas ei mortuo laudes gratiasque congessit, quantas nec vivo umquam egerat nec praesenti. inter divos relatus est. Parallel ist die Angabe bei Hier. chron. 190c: decreto senatus Titus inter deos refertur. Die entsprechende Passage der armenischen Version der Chronik des Euseb lautet hier (in der deutschen Wiedergabe von Karst): „Der Sinklitos erließ einen Beschluss, wonach Titos Gott genannt ward.“56 Damit ist klar, dass in diesem Fall Hieronymus trotz des paganen Inhalts und trotz der Übereinstimmungen mit Eutrop aus der Chronik des Euseb geschöpft hat.
Das typisch senatorische Thema, dass despotischen Kaisern die Ermordung von Senatoren vorgeworfen wird, findet sich für Domitian bei Eutr. 7,23,2. Diese Passage hat ihre scheinbare Entsprechung bei Hier. chron.S. 21191h: Domitianus multos nobilium perdidit, quosdam vero et in exilium misit. Sie stammt aber aus der Chronik, wie wieder die Parallele mit der armenischen Übersetzung des Euseb deutlich macht57.
Das Gros der ähnlichen Passagen zwischen Eutrop und Hieronymus ist aber dadurch zu erklären, dass Hieronymus die Übersetzung der Chronik Eusebs mit Notizen aus lateinischen Quellen ergänzt hat. Dabei hat er, wie durch die Forschungen Helms erwiesen ist, vermutlich nicht oder jedenfalls nicht immer Eutrop, sondern eine mit diesem gemeinsame Quelle benutzt58.
Als Beispiel mögen die Nachrichten über den Sieg und den Triumph über Zenobia dienen. Hier ist in der bereits vorgestellten Passage Eutr. 9,13,2 zu lesen:
Zenobiam quoque, quae occiso Odenatho marito Orientem tenebat, haud longe ab Antiochia sine gravi proelio cepit, ingressusque Romam nobilem triumphum quasi receptor Orientis Occidentis egit praecedentibus currum Tetrico et Zenobia. qui quidem Tetricus corrector Lucaniae postea S. 22fuit ac privatus diutissime vixit; Zenobia autem posteros, qui adhuc manent, Romae reliquit.
Hieronymus bietet trotz einiger unstrittiger wörtlicher Ähnlichkeiten (vgl. unten die Stellen im Fettdruck) und engster inhaltlicher Übereinstimmung (etwa zur Herrschaft der Zenobia über die Diözese Oriens nach dem Tode des Odainathos oder darüber, dass sie gemeinsam mit Tetricus im Triumph Aurelians vor dem Wagen lief) offenkundig mehr als Eutrop, einschließlich der Ortsangabe zur militärischen Auseinandersetzung (Immae) oder der besonderen Soldatenverbände, die Zenobia zur Verfügung standen59:
Hier. chron. 222e: Zenobia aput Immas haut longe ab Antiochia vincitur, quae occiso Odenato marito Orientis tenebat imperium.
Hier. chron. 222g: Aurelianum Romae triumphantem Tetricus et Zenobia praecesserunt. e quibus Tetricus corrector postea Lucaniae fuit et Zenobia in urbe summo honore consenuit. a qua hodieque Romae Zenobiae familia nuncupatur.
Die Lokalisierung der Schlacht in Immae wird aus der gleichen Quelle auch von Festus geboten, der zudem für das Faktum der Herrschaft der Zenobia über den Orient ganz analog zu Hieronymus formuliert. Festus spricht auch wie Hieronymus nicht nur über den Oriens, sondern über das Orientis imperium60.
Die Übereinstimmungen zwischen Festus, Hieronymus und Eutrop belegen also eindeutig die Existenz einer gemeinsamen, unabhängig von den drei Zeugen benutzten Vorlage. Sie führen allerdings deshalb noch nicht sofort zur EKG. Denn solche engen wörtlichen Abhängigkeiten zwischen den drei Quellen fallen nicht nur für die Geschichte der Kaiserzeit, sondern auch für diejenige der Republik auf61. Alle drei Autoren hängen damit nicht unmittelbar von der EKG ab, sondern von einer Kurzgeschichte, die eine Gesamtdarstellung der Geschichte Roms von der Gründung an bot, dabei aber für die Republik vor allem aus Livius-Epitomen schöpfte, für die KaiserzeitS. 23 dann aus der EKG62. Es ist dabei ohne Weiteres wahrscheinlich, dass die meisten Angaben bei Eutrop, Hieronymus und Festus mittelbar aus der EKG stammen63. Die Benutzung zusätzlicher Informationen aus anderem Material und aus anderen Quellen ist aber gleichwohl nicht ausgeschlossen. Stellen, in denen allein Übereinstimmungen zwischen Eutrop, Hieronymus und Festus (in dieser Edition die Rubriken a–c) auffallen, können daher im Sinne des Ökonomieprinzips nicht zwingend der EKG zugewiesen werden. Es sind vielmehr immer zusätzliche Kriterien anzuführen, die eine Zuordnung der Gemeinsamkeiten von Eutrop und Hieronymus nicht nur zur Zwischenquelle, sondern zur EKG selbst erlauben64. Völlig klar sind alle Fälle, in denen neben diesen drei Quellen auch noch Aurelius Victor einen Hinweis auf den Inhalt der EKG gibt. Im diskutierten Fall des Triumphes Aurelians über Zenobia und Tetricus sind es beispielsweise die parallelen Bemerkungen des Aurelius Victor, der zwar Zenobia ignoriert, aber über den Triumph über Tetricus berichtet, sowie die Nachrichten der Historia Augusta.
S. 24b) Hieronymus, Eutrop und der Suetonius auctus (= EKG)
Ein weiteres Kriterium für die Bestimmung der Provenienz von Passagen aus der EKG könnte die Nähe zu Sueton bzw. zu dem von Cohn postulierten Suetonius auctus sein, die immer wieder bei den drei Autoren zu entdecken ist. Der Suetonius auctus wird meistens mit dem ersten Teil der EKG identifiziert65.
Die Hypothese der Existenz einer Redaktion Suetons erklärt zunächst einen Teil des besonderen Verhältnisses zwischen Aurelius Victor und der Epitome de Caesaribus. Diese hat zwar Aurelius Victor abgeschrieben, bringt aber mehr suetonische Details oder ist manchmal näher an Sueton als Aurelius Victor, manchmal auch bedeutend weiter von der Vorlage entfernt. Bisweilen variieren auch beide Quellen zwar gemeinsam, aber unabhängig voneinander Suetonstoff, was auf eine unabhängig voneinander benutzte Vorlage schließen lässt. Dass Aurelius Victor auch selbständig auf Sueton zurückgreifen konnte und nicht immer die EKG benutzte, wird man schließlich nicht völlig ausschließen können. Aufgrund dieser komplexen Gemengelage sollen Passagen bei Aurelius Victor und in der Epitome de Caesaribus, die aus Sueton oder aus dem Suetonius auctus stammen, für die Rekonstruktion der EKG nur dann benutzt werden, wenn zusätzliche Übereinstimmungen mit Eutrop oder Hieronymus auffallen.
Auch für Hieronymus und Eutrop sind wie bei Aurelius Victor durchaus häufig enge Beziehungen zu Sueton zu beobachten, die auf den Suetonius auctus bzw. auf die EKG zurückgeführt werden. Als Beispiel für die Nähe zu Sueton mag die Nachricht über das von Titus eingeweihte Kolosseum dienen:
Eutr. 7,21,4: hic Romae amphitheatrum aedificavit et quinque milia ferarum in dedicatione eius occidit.
Hier. chron. 189d: Titus amphitheatrum Romae aedificat et in dedicatione eius quinque milia ferarum occidit66.
Beide Autoren geben in evidenter Weise den Wortlaut Suetons wieder, vgl. Suet. Tit. 7,3: amphitheatro dedicato … dedit quinque milia omne genus ferarum. Beide bieten allerdings auch den gleichen Fehler, nämlich dass Titus das Kolosseum errichtet haben soll, während es bei Sueton nur um die Einweihung des abgeschlossenen Baus geht.
S. 25Immer wieder lässt sich aber auch zeigen, dass Hieronymus manchmal deutlicher an Sueton anklingt als Eutrop. Das zeigt sich etwa in einem Detail zur Biographie Neros (mit Rückverweisen auf Caligula):
Suet. Cal. 37,1: ut calidis frigidisque unguentis lavaretur.
Suet. Nero 30,3: piscatus est rete aurato et purpura coccoque funibus nexis.
Eutr. 7,14,1: Nero … inusitatae luxuriae sumptuumque, ut qui exemplo C. Caligulae in calidis et frigidis lavaret unguentis, retibus aureis piscaretur, quae blattinis funibus extrahebat.
Hier. chron. 182c: Nero tantae luxuriae fuit, ut frigidis et calidis lavaretur unguentis retibusque aureis piscaretur, quae purpureis funibus extrahebat67.
Einen ganz versteckten, nuancierten Hinweis auf Sueton gibt Hieronymus im Zusammenhang mit dem von Nero gelegten Brand, wo nur Eutrop vom Brand der Stadt schlechthin, Hieronymus dagegen vom Brand des größten Teils Roms spricht:
Suet. Nero 38,1 f.: incendit urbem … praeter immensum numerum insularum domus priscorum ducum arserunt … hoc incendium prospectans Halosin Ilii … decantavit.
Eutr. 7,14,3: urbem Romam incendit, ut spectaculi eius imaginem cerneret, quali olim Troia capta arserat.
Hier. chron. 183g: Nero ut similitudinem Troiae ardentis inspiceret, plurimam partem Romanae Urbis incendit.68
Ein weiteres Beispiel, bei dem sich bei Hieronymus eindeutig eine größere Nähe zu Sueton erkennen lässt als bei Eutrop, bietet die Nachricht über die Gold- und Silberstatuen für den Herrscher Domitian.
Suet. Dom. 13,2: statuas sibi in Capitolio non nisi aureas et argenteas poni permisit ac ponderis certi.
Eutr. 7,23,2: nullam sibi nisi auream et argenteam statuam in Capitolio passus est poni.
S. 26Hier. chron. 191c: Domitianus tantae superbiae fuit ut aureas et argenteas statuas sibi in Capitolio poni iusserit69.
Es fehlt aber auch nicht an Stellen, in denen Eutrop Suetonstoff bzw. Sueton erweiternden Stoff bietet und sich hierfür keine Parallelen bei Hieronymus finden. Das gilt etwa für die Nachricht über die Einrichtung der Provinzen Dalmatien und Raetien unter Augustus, wo Eutrop einerseits die Formulierungen Suetons aufgreift, andererseits mehr zur Geschichte Dalmatiens und zur Unterwerfung von Schwarzmeerstädten berichtet:
Eutr. 7,9: (adiecit imperio) Cantabriam, Dalmatiam saepe ante victam, sed penitus tunc subactam, Pannoniam, Aquitaniam, Illyricum, Raetiam, Vindelicos et Salassos in Alpibus, omnes Ponti maritimas civitates, in his nobilissimas Bosphorum et Panticapaeum.
Suet. Aug. 21,1: Cantabriam, Aquitaniam, Pannoniam, Delmatiam cum Illyrico omni, item Raetiam et Vindelicos ac Salassos, gentes Inalpinas (coercuit).
In diese Serie imperialer Erwerbungen gehört auch die Nachricht über die Zugewinnung von Ägypten für die römische Herrschaft, die bei Sueton selbst nicht zu finden ist. Hier unterscheidet sich Eutrop in seinen Formulierungen von Hieronymus und Festus und bietet die zusätzliche Information, dass Ägypten in das Imperium Romanum integriert wurde. Hieronymus betont dagegen, dass Ägypten eine provincia wurde. Tenor des Suetonius auctus bzw. der EKG muss also gewesen sein, dass Ägypten als Provinz dem römischen Reich hinzugefügt wurde70:
Eutr. 7,7: Aegyptus per Octavianum Augustum imperio Romano adiecta est.
Eutr. 7,9: Romano adiecit imperio Aegyptum.
Hier. chron. 162b: Aegyptus fit Romana provincia.
Identisch mit Sueton (und ohne Parallelen mit Hieronymus) sind die Nachrichten Eutrops über die Vertreibung der Germanen über die Elbgrenze S. 27oder über die Wiedergewinnung der verloren gegangenen Feldzeichen von den Parthern:
Eutr. 7,9: ipsos quoque (Germanos) trans Albim fluvium summovit. … reddiderunt etiam signa Romana, quae Crasso victo ademerant.
Suet. Aug. 21,1: Germanos ultra Albim fluvium summovit.
Suet. Aug. 21,3: signa militaria, M. Crasso et M. Antonio ademerant, reposcenti reddiderunt.71
Was Nero betrifft, so hat Eutrop aufs Ganze betrachtet deutlich mehr Suetonstoff als Hieronymus. Ohne Parallele bei Hieronymus sind etwa die Ausführungen über die außenpolitischen Katastrophen:
Eutr. 7,14,4: Britanniam paene amisit. nam duo nobilissima oppida capta illic atque eversa sunt. Armeniam Parthi sustulerunt legionesque Romanas sub iugum miserunt.
Suet. Nero 40,2: Britannia Armeniaque amissa.
Suet. Nero 39,1: clades Britannica, qua duo praecipua oppida magna civium sociorumque caede direpta sunt. ignominia ad Orientem legionibus in Armenia sub iugum missis aegreque Syria retenta.72
Hinzuweisen ist auf die von Eutrop gebotene Biographie Vespasians, in der sich wörtliche Anklänge an Sueton wiederfinden, aber von zweiunddreißig (statt nur von dreißig) Kämpfen die Rede ist.
Eutr. 7,19,1: princeps obscure quidem natus, sed optimis comparandus, privata vita inlustris, ut qui a Claudio in Germanian et deinde in Brittaniam missus tricies et bis cum hoste conflixerit, duas validissimas gentes, viginti oppida, insulam Vectam, Brittaniae proximam, imperio Romano adiecerit.
Suet. Vesp. 4,1: Claudio principe Narcissi gratia legatus legionis in Germaniam missus est; inde in Britanniam translatus tricies cum hoste conflixit. duas validissimas gentes superque viginti oppida et insulam Vectem, Britanniae proximam, in dicionem redegit partim Auli Plauti legati consularis partim Claudii ipsius ductu.
Bei der Angabe über die Trauer über den Tod des Titus gibt Eutrop den Inhalt Suetons zunächst frei und dann wörtlich wieder. Auch hier findet sich keine Parallele bei Hieronymus.
Eutr. 7,22,2: tantus luctus eo mortuo publicus fuit, ut omnes tamquam in propria doluerint orbitate. senatus obitu ipsius circa vesperam nuntiato S. 28nocte inrupit in curiam et tantas ei mortuo laudes gratiasque congessit, quantas nec vivo umquam egerat nec praesenti.
Suet. Tit. 11: quod ut palam factum est, non secus atque in domestico luctu maerentibus publice cunctis, senatus prius quam edicto convocaretur ad curiam concurrit, obseratis adhuc foribus, deinde apertis, tantas mortuo gratias egit laudesque congessit, quantas ne vivo quidem umquam atque praesenti73.
Betrachtet man diese Parallelen und Unterschiede in ihrer Gesamtheit, lassen sich Vermutungen darüber anstellen, wie sich Suetonius auctus, EKG und die von Eutrop, Hieronymus und Festus benutzte gemeinsame Vorlage zueinander verhalten. Die Tradierung von Suetonstoff kann man durch ein Stemma veranschaulichen, in dem der Weg von Suetonius auctus über die EKG zur (aus der Republikgeschichte und der EKG kombinierenden) „Römischen Geschichte“ führt, aus der Eutrop, Festus und Hieronymus schöpfen:
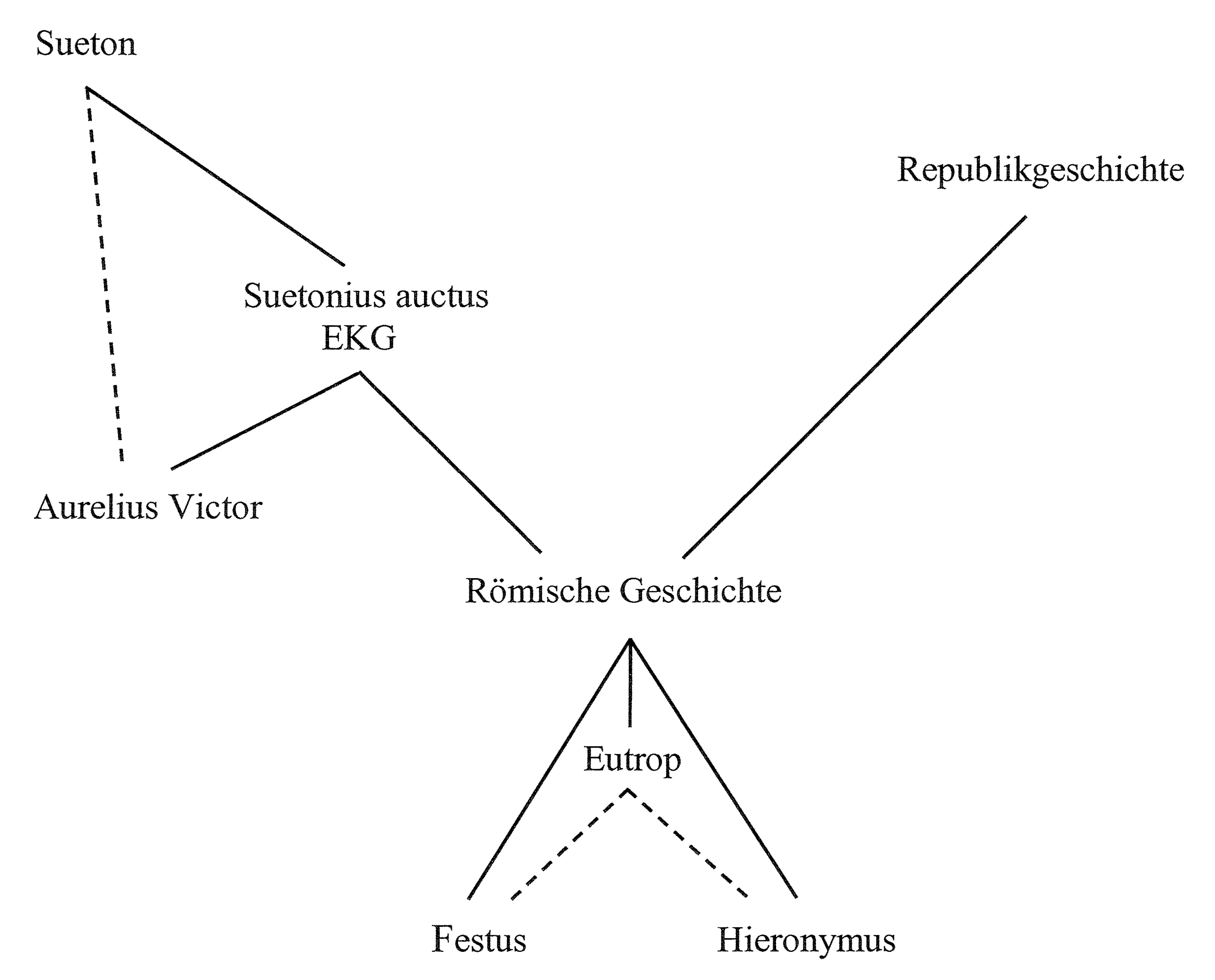
Suetonische Formulierungen und Erweiterungen der Darstellung Suetons, die insbesondere bei Eutrop und Hieronymus festgestellt werden können, die sich aber schon in der „Römischen Geschichte“ fanden, würden damitS. 29 nur über die Vermittlung der EKG bzw. die Konsultation des Suetonius auctus zu erklären sein. Das wird auch bei einem Teil solcher Passagen bei Aurelius Victor der Fall sein. Diese Hypothese wird durch das oben aufgeführte Stemma verdeutlicht.
Es kann gleichwohl aber nicht ausgeschlossen werden, dass die von Eutrop und Hieronymus benutzte „Römische Geschichte“ mitunter genauso direkt auf Sueton und/oder sonstige Suetonepitomen zurückgegriffen hat, wie es für Aurelius Victor vermutet und für die Epitome de Caesaribus mit Sicherheit festgehalten werden kann. Man hätte es dann hier mit dem nicht seltenen Fall zu tun, dass ein ausführlicheres Geschichtswerk (bzw. die Quelle, nämlich der Suetonius auctus) gemeinsam mit der Zusammenfassung (die EKG) benutzt wurde und dass aus Grundquelle und Zusammenfassung ein neumontierter Text entstand. Wegen der Eventualität direkter Rückgriffe auf Sueton schien es angebracht, nicht alle suetonischen Entlehnungen, die bei Eutrop und Hieronymus zu finden sind, unter die Fragmente der EKG aufzunehmen. Vielmehr sind in ökonomischer Weise nur die Fälle berücksichtigt, in denen, entsprechend der von Enmann formulierten Grundhypothese, neben den Übereinstimmungen mit Sueton auch Übereinstimmungen mit Aurelius Victor sowie spezifische Varianten und Erweiterungen zu beobachten sind.
c) Hieronymus und Aurelius Victor
In einigen Fällen ist schließlich Hieronymus dem Wortlaut des Aurelius Victor näher als Eutrop. Meistens ist dies ein genauso eindeutiges Indiz für die Benutzung der EKG wie ein Zusammentreffen von Aurelius Victor und Eutrop. Gleichwohl sind nicht alle Stücke, in denen sich Hieronymus und Aurelius Victor berühren, in diese Zusammensicht aufgenommen. Helm diskutiert etwa folgenden Fall74:
Hier. chron. 233c und 233d: Romani Gothos in Sarmatarum regione vicerunt. Constans, filius Constantini, provehitur ad regnum.
Aur. Vict. 41,13: interea Gothorum Sarmatarumque stratae gentes filiusque cunctorum minor, Constans nomine, Caesar fit.
Eutr. 10,7,1 berichtet weder von der Erhebung des Constans noch vom Sieg über die Sarmaten, sondern nur über Gotensiege nach dem Bürgerkrieg gegen Licinius: etiam Gothos post civile bellum varie profligavit. Die ZuS. 30sammenschau der Passagen führt also in diesem Fall nicht zur Rekonstruktion einer allen drei Autoren gemeinsamen Grundquelle und bietet somit keine Aussage über die Gestalt der EKG.
Übereinstimmungen zwischen Aurelius Victor und Hieronymus finden sich vor allem für im Chronikstil aufgeführte Ereignisse im Osten des Reiches, aber auch für Kurznotizen zur kaiserlichen Dynastie. Mitunter sind in diesen Fällen auch einige Übereinstimmungen des Aurelius Victor mit Theophanes zu konstatieren, etwa in der Darstellung zu Calocaerus75 oder zu dem von Gallus niedergeschlagenen jüdischen Aufstand. Aurelius Victor hat also – anders als Eutrop – bisweilen eine Vielfalt von Quellen benutzt, zu denen auch diese östliche Chronik gehört, die teilweise auch von Hieronymus reflektiert wird76. Es handelt sich um eine Vorgängerin der bekannten Consularia Constantinopolitana, einer Chronik, die sowohl von Aurelius Victor als auch vom anonymen homöischen Historiker benutzt worden ist77. Alle Stücke des Aurelius Victor, die sich auf diese Fastenquelle zurückführen lassen, sind aus der Rekonstruktion der EKG auszuklammern. Zwar ist nicht auszuschließen, dass solche offiziösen Fastennachrichten auch Eingang in die EKG fanden78. Da aber Aurelius Victor ein reiches und divergieS. 31rendes Quellenmaterial benutzte, können solche Notizen ihm auch auf anderen Wegen als dem über die EKG zugeflossen sein. Die Rekonstruktion der EKG ist sicherer, wenn diese Notizen ausgeklammert werden.
4. Festus
Neben Hieronymus bietet, wie bereits erwähnt, auch Festus immer wieder Formulierungen und Inhalte, die mit denjenigen Eutrops eng verwandt sind. Dabei ist nicht auszuschließen, dass Festus in einigen Fällen auf die annähernd zeitgleich erschienene Arbeit Eutrops zurückgegriffen hat. In anderen Fällen ist offenkundig die gleiche Vorlage benutzt worden, auf die auch Hieronymus und Eutrop rekurriert haben, also die wiederholt erwähnte „Römische Geschichte“, die ihrerseits die EKG benutzt hat.79 Das eben erwähnte Beispiel mit dem Bericht über die Integration Ägyptens in das römische Reich lässt sich durch die bei Festus zu entdeckende Nachricht vervollständigen:
Eutr. 7,7: Aegyptus per Octavianum Augustum imperio Romano adiecta est.
Hier. chron. 162b: Aegyptus fit Romana provincia.
Ruf. Fest. 13,3: Aegyptus … provinciae formam Octaviani Caesaris Augusti temporibus accepit.80
Hier ist der Beitrag des Festus deshalb wertvoll, weil er mit der Angabe des Hieronymus übereinstimmt und damit bestätigt, dass Hieronymus mit seiner Angabe über die Umwandlung Ägyptens in eine römische Provinz nicht lediglich Eutrop variiert, sondern über die „Römische Geschichte“ einen von Eutrop unabhängigen Zugang zur Grundquelle (Suetonius auctus) mit qualitätsvollen Angaben hat. Grundsätzlich führen aber auch hier die Gemeinsamkeiten zwischen Hieronymus, Eutrop und Festus allein noch nicht zur EKG, sondern nur zur gemeinsamen Vorlage dieser drei eng verwandten Quellen, also einem Abriss einer gesamtrömischen Geschichte. In der Regel hat, wie bereits erläutert, diese Geschichte die EKG benutzt, kann aber immer wieder im Einzelnen auch weitere Quellen, etwa den Suetonius S. 32auctus, unabhängig von der EKG benutzt haben. Im Fall der Erhebung von Ägypten zur Provinz hat man aber noch ein zusätzliches Indiz für die Zuweisung an die EKG, nämlich Ähnlichkeiten, die im Vergleich mit Aurelius Victor auffallen81.
5. Polemius Silvius
Eine extreme Kurzfassung einer Serie kaiserlicher Biographien bietet der im Sammelwerk des Polemius Silvius enthaltene Laterculus aus der Mitte des fünften Jahrhunderts. In einigen Punkten fallen dort Übereinstimmungen mit Zeugen der EKG auf, doch ist unklar, inwiefern Polemius Silvius die EKG direkt benutzt hat82. Weitaus die meisten Übereinstimmungen erklären sich jedenfalls damit, dass Polemius Silvius vor allem Aurelius Victor kannte. Einige wertvolle Informationen des Polemius Silvius stimmen partiell mit der Historia Augusta überein, allerdings gerade für Passagen, die landläufig eben nicht der EKG, sondern einer ausführlicheren historiographischen Quelle zugewiesen werden. Das betrifft etwa die Angaben über östliche und illyrische Usurpatoren in der Zeit des Gallienus (Macrianus und Quietus), die Söhne des Gallienus oder über Usurpatoren unter Aurelian (Vaballathus), die der gemeinsamen Quelle des Aurelius Victor und Eutrop nicht bekannt waren. Vereinzelte Informationen zur konstantinischen Zeit teilt Polemius Silvius mit der Origo Constantini83, aber auch hier für Teile dieses Werks, die mit den übrigen Zeugen der EKG-Tradition keine Berührung haben, nämlich in den Spezialangaben über Valens, den ephemeren Mitregenten des Licinius, oder die Königsstellung des Hannibalianus. Es kann zwar nicht ausgeschlossen werden, dass in wenigen Fällen Polemius Silvius auf eine Quellenschicht zurückgreift, die älter als Aurelius Victor und Eutrop ist. Die meisten Informationen scheinen aber aus bekannten Quellen zusammengetragen worden zu sein, allen voran, wie bereits betont, aus Aurelius Victor. Polemius Silvius wird aus diesem Grund bei der Frage der Rekonstruktion der Kaisergeschichte nur dann aufgeführt, wenn einerseits keine Übereinstimmung mit Aurelius Victor zu verzeichnen ist und wenn andererseits aufgrund der Übereinstimmung mit anderen Zeugen derS. 33 EKG ein von Aurelius Victor und sonstigen bekannten Zwischenquellen unbeeinflusster Zugriff zur EKG angenommen werden kann. Es handelt sich um eine sehr geringe Anzahl von Fällen.
6. Synkellos und byzantinische Autoren
Ohne Anspruch auf Vollständigkeit sind bei der Rekonstruktion der Fragmente der EKG auch Stücke verwendet worden, die bei Synkellos zu finden sind84. Da sie Eutrop sehr nahekommen, ist hier zunächst die Erklärung möglich, dass Synkellos eine dritte griechische Eutrop-Übersetzung benutzte, die neben derjenigen des Paianios und des „Kapiton Lykios“ (in Stücken bei Johannes Antiochenus) nachweisbar ist. In einigen Passagen bietet Synkellos aber anscheinend von Eutrop unabhängige, zusätzliche Informationen. Nachweisbar ist dies etwa für Einzelelemente in der Biographie des Carus85. Diese Ähnlichkeiten mit Eutrop fallen nicht nur für kaiserzeitliche Stücke auf86, sondern vereinzelt bereits für die römische Republik. So nennt Synkellos als einziger neben Eutrop den Konsul Cornelius Lentulus als Kämpfer gegen Pyrrhus, wovon die übrige Tradition nichts weiß87. Synkellos repräsentiert also nicht unbedingt die EKG, sondern eine griechische Bearbeitung jener römischen Gesamtgeschichte, die auch Eutrop, Hieronymus und Festus vorgelegen hat88. Auf andere byzantinische Chroniken, etwa auf Malalas, der eine Kaisergeschichte benutzt hat89, wurde nicht eingegangen. Berührungen zwischen Eutrop und Theophanes, dem Fortsetzer des Synkellos, sind damit zu erklären, dass bei Theophanes eine (nach PaianiosS. 34 und Kapiton Lykios) dritte griechische Eutrop-Übersetzung benutzt worden ist90, und wurden daher ebenfalls nicht berücksichtigt.
7. Ammianus Marcellinus
In einer ganz geringen Anzahl von Fällen hat auch Ammianus Marcellinus für seine Rückblenden die Tradition der EKG benutzt91.
IV. Zur Diskussion weiterer eventueller Textzeugen
1. Origo Constantini (Anonymus Valesianus, 1. Teil)
Eine Anregung von S. Mazzarino aufgreifend, hat G. Zecchini in einem Aufsatz, dessen Positionen er später revidiert hat, in der Origo Constantini das einzige erhaltene vollständige Fragment der EKG erkannt92. Jenseits der Stücke, die aus Orosius und damit indirekt aus Eutrop entlehnt sind, gibt es im ersten Teil der Origo (bis Kapitel 13) Passagen, für die man eine Entsprechung mit der gemeinsamen Quelle des Eutrop und des Aurelius Victor konstatieren kann. Eine ziemlich enge Entsprechung findet sich in der Nachricht, dass Constantius I. in Eburacum (York) verstarb und Konstantin im Konsens zu dessen Nachfolger erhoben wurde93, und besonders deutlich in der Notiz über die Nachkommen des Constantius I.: relicta enim Helena priore uxore, filiam Maximiani Theodoram duxit uxorem, ex qua postea sex liberos Constantini fratres habuit. sed de priore uxore Helena filium iam Constantinum habuit, qui postea princeps potentissimus fuit (Origo Const. 1). Zu vergleichen ist hier Eutr. 9,22,1: Constantius privignam HerculiiS. 35 Theodoram accepit, ex qua postea sex liberos, Constantini fratres, habuit, Galerius filiam Diocletiani Valeriam, ambo uxores, quas habuerant, repudiare conpulsi94. Beide Stellen mit den Angaben über die Verstoßung der früheren Frau sowie insbesondere mit der identischen Wendung ex qua postea sex liberos, Constantini fratres habuit sind unzweifelhaft miteinander verwandt. Diese Verwandtschaft scheint nicht durch Orosius (7,25,5) vermittelt worden zu sein, der geringfügig abweichend formuliert: Constantius Herculii Maximiniani privignam Theodoram accepit uxorem, ex qua sex filios fratres Constantini sustulit. Dagegen findet man bei Hieronymus eine mit Eutrop und der Origo Constantini identische Formulierung. Weitere zu diskutierende parallele Wendungen finden sich beispielsweise in Eutr. 10,2,1, Aur. Vict. 40,1 und Origo Const. 5; Eutr. 10,2,2–4, Aur. Vict. 40,5–7 und Origo Const. 6; Eutr. 10,4,1 f. und Origo Const. 8 sowie Origo Const. 13. Eine Verwandtschaft der Quellen ist für diese Fälle nicht zu leugnen, aber die komplexe Gemengelage, bei der auch Gemeinsamkeiten mit Zosimos zu diskutieren sind und in der die Origo meist durch Besonderheiten und Abweichungen auffällt, führt eher zur Ermittlung einer Vorstufe der EKG95. Ab dem Kapitel 13 sind Berührungspunkte der Origo Constantini mit Aurelius Victor, Eutrop und Hieronymus deutlich seltener96. In der Regel werden angesichts des uneindeutigen Befunds hier keine Passagen der Origo Constantini für die Rekonstruktion der EKG hinzugezogen. Zu verweisen ist auf die Diskussion in KFHist C 3.
2. Origo gentis Romanorum
Die Origo gentis Romanorum enthält in ihrer Darstellung eine Reihe von Notizen zu kaiserlichen Bauaktivitäten in Rom. Diese Notizen werden in KFHist B 5 diskutiert. Einige der Notizen über Baumaßnahmen finden sich auch bei Hieronymus und in der Historia Augusta, während Eutrop sie meistens nicht kennt97. In den wenigen Fällen, in denen bei Eutrop Parallelen zu S. 36finden sind, lassen sich Abweichungen konstatieren. Dass es dabei um Nuancen gehen kann, zeigt das von Helm diskutierte Problem der Gemeinsamkeiten zu Neros Thermen. Hier. chron. 183d bietet: thermae a Nerone aedificatae quas Neronianas appellavit. Demgegenüber ist bei Eutr. 7,15,2 zu lesen: aedificavit Romae thermas, quae ante Neronianae dictae nunc Alexandrinae appellantur. Nur von der Errichtung der Thermen des Severus Alexander berichtet die Origo gentis Romanorum: thermae Alexandrinae dedicatae sunt98. Hier konstatiert Helm: „Auffällig ist, dass H. [Hieronymus], wenn er sie in seiner Quelle vorfand, die spätere Umnennung der Thermen in der Zeit des Alexander Severus nicht mitanführt, da er bzw. Eusebius, bei anderer Gelegenheit die Namensänderung mit Vorliebe erwähnt.“99 Hieronymus benutzt also hier nicht die Chronik des Eusebius, sondern die mit Eutrop gemeinsame Quelle, aber unabhängig von Eutrop, weshalb die Namensänderung fehlt.
Was das Verhältnis zwischen der gemeinsamen Quelle des Hieronymus und Eutrops einerseits und der Origo gentis Romanorum andererseits betrifft, muss es wiederum eine gemeinsame Quelle gegeben haben100. Denn die Origo gentis Romanorum, die vor dem Chronographen von 354 entstanden und erst nachträglich in den Chronographen integriert worden ist, kann die Kaisergeschichte, mit der sie viele Parallelen zeigt, selbst noch nicht benutzt S. 37haben, Hieronymus enthält aber umgekehrt durchaus partiell richtigere Angaben als die Origo. Die Parallelen verweisen also auf eine Quellenschicht, die älter ist als die bis 357 reichende gemeinsame Quelle von Aurelius Victor und Eutrop. Dabei finden sich einige Berührungen zwischen Zeugen der EKG einerseits und der Origo andererseits, durchaus auch in den ereignisgeschichtlichen Kurznachrichten, vor allem in Notizen zum Ende diverser Kaiser. Folgende Entsprechungen zu den Stücken der EKG (in der in dieser Ausgabe vorgeschlagenen Numerierung) lassen sich aufzählen:
fr. 14 (Ende des Titus), vgl. Origo Rom. 45 (KFHist B 5): excessit Curibus Sabinis cubiculo patris.
fr. 17 (Bauten Domitians), vgl. Origo Rom. 46 (KFHist B 5): hoc imperante multae operae publicae fabricatae sunt: atria VII, horrea piperataria, ubi modo est basilica Constantiniana, et horrea Vespasiani, templum Castorum et Minervae, portam Capenam, gentem Flaviam, Divorum, Iseum et Serapeum, Minervam Chalcidicam, odeum, Minuciam veterem, stadium et thermas Titianas et Traianas, amphitheatrum usque ad clipea, templum Vespasiani et Titi, Capitolium, senatum, ludos IIII, palatium, Metam sudantem et pantheum.
fr. 54 (Bauten des Septimius Severus), vgl. Origo Rom. 56 (KFHist B 5): hoc imperante Septizonium et thermae Severianae dedicatae sunt.
fr. 58 (Inzest Caracallas), vgl. Origo Rom. 58 (KFHist B 5): hic suam matrem habuit.
fr. 59 (Bauten Caracallas), vgl. Origo Rom. 58 (KFHist B 5): hoc imperante ianuae circi ampliatae sunt et thermae Antoninianae dedicatae sunt.
fr. 63 (Heliogabalium in Rom), vgl. Origo Rom. 60 (KFHist B 5): Heliogabalium dedicatum est.101
fr. 66 (Thermen des Severus Alexander), vgl. Origo Rom. 61 (KFHist B 5): et thermae Alexandrinae dedicatae sunt.
fr. 70 (Ende des Pupienus und des Balbinus), vgl. Origo Rom. 64 (KFHist B 5): occisi Romae.
fr. 71 (Ende Gordians III.), vgl. Origo Rom. 65 (KFHist B 5): excessit finibus Parthiae.
fr. 76 (Ende des Philippus Arabs und seines Sohnes), vgl. Origo Rom. 66 (KFHist B 5): occisus senior Verona, iunior Romae in castris praetoriis.
fr. 78 (Bauten des Decius), vgl. Origo Rom. 67 (KFHist B 5): hoc imperante thermae Commodianae dedicatae sunt.
S. 38fr. 80 (Gallus und Volusianus), vgl. Origo Rom. 68 (KFHist B 5): Gallus et Volusianus imperaverunt annos II, menses IIII, dies IX. … his imperantibus magna mortalitas fuit. occisi in Foro Flamini.
fr. 89 (Quintillus), vgl. Origo Rom. 72 (KFHist B 5): Quintillus imperavit dies LXXVII. … occisus Aquileia.
fr. 91 (Aurelianus), vgl. Origo Rom. (KFHist B 5): hic muro urbem cinxit. templum Solis et castra in campo Agrippae dedicavit. genium populi Romani aureum in rostra posuit. porticus thermarum Antoninianarum arserunt et fabricatae sunt. panem, oleum et salem populi iussit dari gratuite. agonem Solis instituit. occisus Caenophrurio.
fr. 113 (Triumph Diokletians und Maximians), vgl. Origo Rom. 79 (KFHist B 5): regem Persarum cum omnibus gentibus ⟨ ⟩ et tunicas eorum ex margaritis numero XXXII circa templa domini posuerunt; … excessit Diocletianus Salonas, Maximianus in Gallia.
In welchem Verhältnis die gemeinsame Quelle von Origo und EKG wiederum zur Chronik Eusebs steht, bleibt der Diskussion unterworfen102.
Festgestellt werden kann, dass Hieronymus vermutlich alle Einträge, die mit der Origo übereinstimmen, aus der EKG entnommen hat. Diese berichtete, gerade was die Bauten betrifft, in einigen Punkten ausführlicher und gab die gemeinsame Grundquelle besser wieder als die Origo, die allerdings manchmal ihrerseits ausführlicher war. Es ist eher unwahrscheinlich, dass Hieronymus neben der EKG gesondert eine Chronik benutzt hat, die einS. 39 Verzeichnis kaiserlicher Bauaktivitäten in Rom bot. Weil man diese Möglichkeit freilich nicht mit letzter Gewissheit ausschließen kann103, werden die seltenen Passagen, in denen nur eine Übereinstimmung zwischen Hieronymus und Origo auffällt, die aber nicht mit Parallelen bei sonstigen Zeugen der EKG hinterlegt werden können, nicht in die Sammlung von EKG-Fragmenten aufgenommen104.
3. Die Historia adversus paganos des Orosius
Die 417 verfasste Historia adversus paganos enthält zwar für den Bericht der Zeit von Augustus bis Constantius II. zahlreiche mit den übrigen EKG-Zeugen übereinstimmende Passagen. Diese gehen aber auf Eutrop bzw. Hieronymus zurück105. Eine selbständige Benutzung der EKG ist auszuschließen.
4. Die Caesares des Julian
In den Caesares Julians werden im Zusammenhang mit der Vorstellung der am Symposion teilnehmenden Kaiser einige Charakteristika angegeben, die Ähnlichkeiten mit der Darstellung der EKG zeigen. Die Einzelheiten sind hier von Alföldi zusammengetragen worden106. Dazu gehören etwa die Charakterisierung des Gallienus als effeminierter und nachlässiger Herrscher107, der Großmut des Claudius Goticus108, die Grausamkeit Aurelians109 und die Wollust und Treulosigkeit des Maximianus Herculius110. Wieweit alle der von Alföldi zusammengetragenen Parallelen wirklich auf die EKG verweisen, ist bei einigen Details unsicher, wie den angeblich von Probus zurückeroberten 70 gallischen Städten, von denen neben Julian nur die Historia Augusta S. 40berichtet, aber in einem Kontext, der gerade nicht aus der EKG stammt111. In anderen Fällen berichtet Julian auch mit der EKG unvereinbare Versionen, etwa hinsichtlich der Beteiligung des Pertinax am Mord an Commodus112. Grundsätzlich ist die Annahme, dass Julian die EKG zur Kenntnis genommen hat, plausibel und die von Alföldi hervorgehobenen Berührungspunkte sind durchaus bemerkenswert. Gleichwohl wurde auf eine Berücksichtigung der Passagen der Caesares verzichtet, schon deshalb, weil in keinem Fall wörtliche Bezüge oder sonst besonders spezifische inhaltliche Gemeinsamkeiten konstatiert werden können.
V. Die Frage der Fortsetzungen der EKG
Die Rekonstruktion der EKG hat einen hohen Grad an Gewissheit, wo Übereinstimmungen zwischen Eutrop und Aurelius Victor auffallen, und sie ist dort besonders sicher, wo diese Übereinstimmungen sich durch einen Bindefehler von der übrigen Tradition unterscheiden. Neben dieser Kernzone gibt es ein diffuseres Umfeld, für das nur wahrscheinliche Aussagen möglich sind. Hier ist von Fall zu Fall zu entscheiden, ob man diese zusätzlichen Zeugnisse berücksichtigen möchte oder nicht. Im Großen und Ganzen hat in der vorliegenden Zusammenstellung das Ökonomieprinzip Anwendung gefunden. Wenn sich Übereinstimmungen zwischen Zeugen anders als durch den Rückgriff auf die EKG als gemeinsame Quelle erklären lassen, sind sie nicht berücksichtigt worden. Eine Ausnahme wurde hier lediglich für die Stellen der Historia Augusta gemacht, die im Rahmen der Diskussion um die Rekonstruktion der EKG immer wieder angeführt werden. Bei ihnen ist die Erklärung, dass Eutrop und Aurelius Victor vom Autor der Historia Augusta einfach kombiniert worden sind, zwar oft naheliegend, sie ist jedoch bisweilen nicht in jeder Hinsicht als befriedigend anzusehen oder wird zumindest in der Historia-Augusta-Forschung kontrovers diskutiert. Auf die S. 41Anwendung weiterer Kriterien, nach denen in dem einen oder anderen Fall auch ohne Quellenparallele die Zuweisung etwa einer Eutroppassage an die EKG möglich sein könnte, etwa bei auffälligen und stereotypen Wiederholungen ähnlicher Ausführungen zu „herkunft, umständen und rechtstitel“ bei der Erhebung von Kaisern113, ist verzichtet worden.
Verzichtet wurde schließlich auch auf die Wiedergabe der Übereinstimmungen, die sich bei Hieronymus, der Epitome de Caesaribus, Eutrop, Festus und Ammianus Marcellinus für die Zeit nachweisen lassen, ab der Aurelius Victor als Zeuge der EKG ausfällt. Das Problem der Übereinstimmungen dieser Zeugnisse ist zuletzt von S. Ratti und R. Burgess behandelt worden. Ratti hat diese Übereinstimmungen mit der Benutzung der gemeinsamen Grundquelle Nicomachus Flavianus erklärt114, Burgess geht dagegen von mehreren Redaktionen der EKG aus115. Die erste Erweiterung ist mit der Redaktion identisch, die von Eutrop und Festus benutzt wurde, die zweite dagegen mit derjenigen, die Hieronymus benutzt haben soll und die mit dem Jahr 378 endete.
Die Beziehungen zwischen den Notizen für die Zeit zwischen 357 und 378 sind wohlbemerkt bereits in der älteren Quellenforschung diskutiert worden116. Helm hat für sie eine überzeugende Erklärung gefunden und auf Redaktionen und Fortsetzungen hingewiesen. Eutrop, Hieronymus und Festus haben aus einer Quelle geschöpft, die auf der einen Seite Ergänzungen für die Zeit bis in die eigene Gegenwart bot und die auf der anderen Seite auch die ältere republikanische Geschichte enthielt: „ (…) wir müssen uns denken, dass ebenso diese Kaisergeschichte, zum mindesten in bestimmten Abständen, eine Ergänzung gefunden hat, um den neueren Zeiten nahezukommen, wie sie auch durch Verschmelzung mit einer Darstellung der älteren Geschichte zu einer vollständigen Geschichte Roms gemacht werden konnte.“117 Dabei ist aber nicht auszuschließen, dass diese Fortsetzung bis in die jüngere Zeit auch wieder zu Geschichtswerken gegriffen hat. Für die Rekonstruktion der EKG genügt es, im Sinne des Ökonomieprinzips – zu S. 42definieren ist die EKG als die Aurelius Victor und Eutrop gemeinsame Grundquelle – nur die Übereinstimmungen zu untersuchen, die bis zum Ende des Aurelius Victor zu konstatieren sind. Die nach 357 auffallenden und nicht immer eindeutigen Übereinstimmungen können zwar, müssen aber nicht auf eine Fortsetzung der EKG zurückgehen.
VI. Zur Charakterisierung der EKG
Das Problem, die Zeit und die Umstände zu bestimmen, unter denen die EKG entstanden ist, ist durch den Befund, dass Eutrop und Aurelius Victor bis in die Regierungszeit des Constantius II. Gemeinsamkeiten aufweisen und aus der gleichen Quelle schöpfen, nicht restlos geklärt. Denn in der gleichen Form, in der für die Zeit von 357 bis 378 die Existenz von Fortsetzungen und Redaktionsstufen vermutet werden kann, besteht natürlich auch für die gemeinsame Quelle des Eutrop und Aurelius Victor die Möglichkeit, dass sie ursprünglich zu einem früheren Termin endete, dann aber durch eine Redaktion fortgeführt wurde, die von Aurelius Victor und von Eutrop ebenso benutzt wurde wie der erste Hauptteil. An eine solche Kombination eines ursprünglichen Werks mit einer Fortsetzung hatte bereits Enmann gedacht, wenn diese Annahme auch lediglich der Notwendigkeit geschuldet war, die Benutzung seiner Kaisergeschichte durch die angeblich in diokletianisch-konstantinischer Zeit endende Historia Augusta zu erklären.
Einen Hinweis darauf, von welchem Standpunkt aus die EKG erarbeitet wurde, bietet die inhaltliche Schwerpunktsetzung. Die EKG stellt eindeutig vor allem die Zeit ab Mark Aurel, die Reichskrise und die Tetrarchie in den Mittelpunkt ihrer Darstellung, während sie für die Regierung der früheren Kaiser knapper vorgeht. Die biographische Form, in der diese Geschichte gegossen ist, und die sehr deutliche Gliederung des Stoffes nach den suetonischen Rubriken, die penible Beachtung der räumlichen und sozialen Herkunft der Kaiser, die genaue Darstellung ihrer Regierungsübernahme, ihrer außen- und innenpolitischen Erfolge, der Umstände ihres Todes und eventuell ihrer Divinisierung118, sollte nicht darüber hinweg täuschen, dass die EKG durchaus auch komplexere ereignisgeschichtliche Partien enthalten haben dürfte, etwa in der Schilderung von Bürgerkriegskonfrontationen in der Reichskrise und in der Tetrarchie oder von einigen äußeren Kriegen.
S. 43Das Kaiserideal, das der Autor in seiner historischen Darstellung entwickelt, ist offenkundig relativ konventionell und entspricht in etwa dem, was wiederholt für Eutrop herausgearbeitet worden ist, nämlich der Verbindung einer respektvollen Haltung gegenüber der senatorischen Aristokratie im Innern und einer aggressiv-imperialen Außenpolitik. Dem Autor der EKG sind genaue Notizen zum Verhältnis zwischen Kaiser und Senat zuzuweisen, aus denen deutlich wird, dass er die Entmachtung des Senats unter Maximinus Thrax und die absolutistischen Attitüden der Tetrarchie verurteilt119. Er verzeichnet historische Zäsuren in der Organisation der kaiserlichen Macht oder Brüche im Wesen des Kaisertums, wobei er von den Realitäten der spätantiken Kollegialherrschaft ausgeht120. Ein besonderes Anliegen ist ihm – und Eutrop hat auch hier großenteils aus seiner Vorlage geschöpft – die genaue Beschreibung der Bildung der Kaiser121. Die Gesamtheit des Reiches wird in den Blick genommen, eine besondere Präferenz für eine Region ist nicht zu erkennen, wenn sich auch relativ viele Informationen zu Gallien finden, insbesondere zum gallischen Sonderreich, aber auch zur Usurpation des Carausius und des Allectus122. Relativ sicher lässt sich auch eine westliche Provenienz des Autors vermuten. Das zeigt etwa das Bild der vom Autor für die Regierung des Gallienus berücksichtigten Tyrannen, wo die Ausklammerung des östlichen Raumes auffällt123. Mit dem Vergilzitat und mit Anleihen aus Sueton (über den Suetonius auctus) und vermutlich Marius Maximus gibt sich der Autor als lateinischer Literat zu erkennen124.
Man kann versuchen, den Autor durch eine Beobachtung der Einstellung zu den einzelnen Kaisern näher zu fassen. Die Bewertungen der frühen Kaiser des Prinzipats folgen im Großen und Ganzen der Darstellung des Sueton. Die Hochschätzung des Mark Aurel und die positive Bewertung des Septimius Severus könnte dem Profil des Marius Maximus entsprochen haben125, wobei der Autor der EKG deutlich eigene Akzente setzt, wie etwa in derS. 44 rückprojizierenden Erfindung einer sonst unbekannten Schlacht an der Milvischen Brücke126. Die scharfe Gegenüberstellung der Fehlleistungen des Gallienus und der Rettungsaktionen der Kaiser des gallischen Sonderreichs verrät eine offenkundig in der tetrarchischen Zeit verbreitete Perspektive127. Das gallische Sonderreich, bzw. „die bestimmt begrenzte folge der gallischen kaiser von Postumus an bis Tetricus“ hat eine „vom plane der biographie ganz unabhängige eigene geschichtsdarstellung“ gefunden, die entstanden sein muss, „als Constantius über Gallien und Britannien waltete“128. Im Rückblick auf die Reichskrise wird dabei Claudius Gothicus in besonderer Weise idealisiert, zweifelsohne deshalb, weil dieser ganz kurz herrschende Kaiser entsprechend der 310 publik gemachten „Entdeckung“ als Ahnherr der konstantinischen Dynastie ausgegeben wurde129. Die positive Darstellung des Claudius könnte ein zusätzlicher Grund dafür gewesen sein, Gallienus besonders ungünstig darzustellen: „Gallienus wird als feiger üppiger gewissenloser regent geschildert. Die übertreibende tendenz, die dabei thätig war, ist die, dessen durch einen kaisermord auf den thron gelangten nachfolger Claudius in seinen tugenden zum gegenstücke des Gallienus zu machen und ihn zugleich als retter des reiches zu legitimiren.“130
Es fällt weiter auf, dass bei der Darstellung der Tetrarchie den Großtaten des Constantius I. eine besonders detaillierte Darstellung zukommt, während der glänzende Persersieg des Galerius immerhin dadurch in ein gewisses Zwielicht gerät, dass die Demütigung des Caesar nach der Niederlage in der ersten Kampagne ausführlich beschrieben wird131. Besonders ungünstig charakterisiert der Autor der EKG den Maximianus Herculius, während der junge Konstantin als exoptatissimus moderator die Bühne der Geschichte betritt und seine von Trier aus unternommenen Großtaten gegen die Franken hervorgehoben werden132. Sein Sieg über Maxentius wird entsprechend der nach 312 ausgegebenen offiziellen Interpretation als Sieg über einen den römischen Senat und die römische Freiheit unterdrückenden Tyrannen ausgegeben. Dass Konstantin in diesem Krieg der Angreifer war, wird wie in den zeitgenössischen panegyrischen Texten durchaus zugegeben, aber als S. 45besondere Rettungstat im Interesse Roms gerühmt133. All diese Themen lassen sich gut erklären, wenn die Darstellung der politischen Geschichte des ausgehenden dritten und beginnenden vierten Jahrhunderts in der Zeit des jungen Konstantin, ungefähr um 313 oder 315 entstanden ist134.
Die anschließende Darstellung der Ereignisse zwischen 313 und 357 zeigt einen eher summarischen Charakter, was darauf hinweisen könnte, dass es sich um Nachträge handelt, die auf einen in tetrarchisch-konstantinischer Zeit entstandenen und nicht mehr überarbeiteten135 Grundstock aufgesetzt worden sind, als die von Aurelius Victor und Eutrop benutzte Fassung 357 in der Umgebung Julians entstand136. Vieles in dieser Darstellung S. 46passt durchaus zur Sicht der Dinge, wie sie am Hof des Constantius II. in den ausgehenden 350er Jahren vertreten wurde. Dazu gehörte etwa die Darstellung, dass Constans zwar durchaus tüchtig, gleichzeitig aber von lasterhaftem Lebenswandel (im Unterschied zum modellhaften Bruder) und damit für die Usurpation des Magnentius gewissermaßen mitverantwortlich war137. Dazu gehören auch die übrigen Nachrichten über die Bezwingung des Vetranio (durch die Redekunst des Kaisers), des Magnentius und des Silvanus138. Sie fügen sich zu der Deutung der jüngsten Vergangenheit, wie man sie insbesondere aus den beiden panegyrischen Reden des Julian Caesar kennt. Das gilt auch für die Betonung des vermeintlich brutalen Charakters des Gallus, mit dem dessen Beseitigung begründet wurde. Diesen Charakter bringt Julian noch im gegen Constantius II. gerichteten Brief an die Athener als Konzession an den Standpunkt des Oberkaisers zur Sprache139. Andere Themen passen dagegen eher in die Zeit, in der der immer selbstbewusster gewordene Caesar die Konfrontation mit dem Oberkaiser vorbereitete. So werden in der summarischen Darstellung der Alleinherrschaft Konstantins die Verwandtenmorde zur Sprache gebracht140. Für die Herrschaft des Constantius II. fällt auf, dass die dubiosen Umstände der Beseitigung des Dalmatius Caesar 337 erwähnt werden141. Der Hinweis auf die sechs Kinder des Constantius I. kann ebenfalls als deutliche Anspielung auf ihr späteres Schicksal – die Ermordung der noch lebenden Halbbrüder Konstantins 337 – verstanden werden.142 Von Bedeutung für die Beurteilung ist schließlich, dass das Geschichtswerk gerade mit dem großen Erfolg Julians gegen die Alamannen schloss und offenkundig bezweckte, Julian als würdigen Nachfolger des Alamannensiegers Constantius I. erscheinen zu lassen.
1 Enmann, passim. Zu A. Enmann (1856–1903) vgl. H. Schlange-Schöningen, Art. Enmann, Alexander, DNP Suppl.-Bd. 6 (2012) 356 f.; J. F. Gilliam, Rostovzeff’s Obituary of Enmann, in: A. Alföldi / J. Straub (Hgg.), BHAC 1977/ 78, Bonn 1980, 103–14.
2Burgess, Principes cum tyrannis, 495–99 vermutet, dass Eusebius von Nantes der Autor dieser Kaisergeschichte war, vgl. zu den Diskussionen um Eusebius von Nantes KFHist A 7 sowie jetzt Schmidt, Eusebius, 627 f.
3 Vgl. P. L. Schmidt, Die sogenannte Enmannsche Kaisergeschichte (= EKG), in: R. Herzog (Hg.), Restauration und Erneuerung. Die lateinische Literatur von 284 bis 374 n. Chr. Handbuch der lateinischen Literatur der Antike. Fünfter Band, München 1989, 196–8, hier 197: „Als notwendiges Postulat zur Erklärung der Verwandtschaft (sprachliche und strukturelle Eigenheiten, sachliche Irrtümer) von Victor, Eutrop, der Historia Augusta (…) hat sie (anders als die Livius-Epitome) den Test der Benutzung bestanden.“ Fündling, Vita Hadriani, 138: „Ihr Gebrauch durch Victor und Eutrop ist praktisch unstrittig.“ S. auch Zinsli, Vita Heliogabali, 84.
4Zecchini, Qualche ulteriore riflessione, 65 f. zitiert das mündliche Statement von Emilio Gabba, der die EKG für eine „pura e semplice invenzione“ hielt, ohne ihm ganz recht zu geben. Er unterstreicht gleichwohl, dass die EKG „un postulato della moderna ricerca, non un’opera, la cui esistenza si fonda su testimonianze antica“ (was niemand bestreitet). Zecchini kommt angesichts der einerseits objektiv gegebenen Übereinstimmungen, andererseits der zahlreichen Unschärfen zum Ergebnis, dass die EKG kein Werk, sondern ein „filone storiografico“ ist (70). Den skeptischen Überlegungen Zecchinis schließt sich Gnoli, Aureliano, 36–9 an. Die EKG sei gleichsam eine „Frage des Glaubens“: I. Lasala Navarro / P. López Hernando, Origo Constantini Imperatoris. Comentario, notas y traducción, Habis 38 (2007) 271–85, hier 274. Zu den skeptischen und vorübergehend sehr einflussreichen Positionen von den Boer, Some Minor Roman Historians s. Burgess, Jerome, 352–4. Ohne die Hypothese der EKG glaubte P. Dufraigne in seiner Aurelius-Victor-Ausgabe (Aurelius Victor, Livre des Césars, Paris 1975) auskommen zu können.
5Philostorgius, Kirchengeschichte. Mit dem Leben des Lucian von Antiochien und den Fragmenten eines arianischen Historiographen, hg. von J. Bidez, 3., bearb. Aufl. von F. Winkelmann, Berlin 1981, Anhang VII. Bidez baut auf Beobachtungen von P. Batiffol, Quaestiones Philostorgianae, Diss. Paris 1891 auf. Grundsätzlich skeptisch zu Bidez P. van Nuffelen, Considérations sur l’anonyme homéen (in Druckvorbereitung), der zu Batiffol zurückkehren möchte.
6 Zu Theophilos vgl. Theophilus of Edessa’s Chronicle and the Circulation of Historical Knowledge in Late Antiquity and Early Islam, translated with an introduction and notes by R. G. Hoyland, Liverpool 2011. Zur Diskussion um Theophilos s. allerdings M. Conterno, La „descrizione dei tempi“ all’alba dell’espansione islamica. Un’indagine sulla storiografia greca, siriaca e araba fra VII e VIII secolo, Berlin 2014. Generelle Skepsis gegenüber der Edition rekonstruierter Werke äußern Van Hoof / Van Nuffelen, Fragmentary Latin Historians, 5 Anm. 23.
7 Vgl. KFHist G 2: Fastenquelle des Sokrates. Zum Problem, ob es eine scharfe Scheidung zwischen Quellenkritik und der (nach eindeutig mit Namen versehenen) Sammlung von Fragmenten im Sinne Jacobys geben kann, s. B. Bleckmann, Weitere Bemerkungen zur Enmannschen Kaisergeschichte, HAC Romanum (in Vorbereitung).
8 Ein Beispiel für eine lediglich aufgrund quellenkritischer Überlegungen erfolgte Zuweisung bietet FGrHist 566 F 164 (angeblich Timaios).
9 Selbst Editionen spätantiker Chroniken, mit ihren dezidierten Annahmen zu Autor und Werk, sind bei genauerem Hinsehen immer das Ergebnis eines konstruierenden Vorgehens. Dazu demnächst die Dissertation von Niklas Fröhlich.
10 Dabei wurde der Text Hohls mit seinem eigentümlichen System von geschweiften und eckigen Klammern, Kursiven etc. vereinfacht.
11 Vgl. die von Enmann, 399 ausgesprochene Warnung vor einer allzu mechanistischen Konzeption: „Man fühlt sich versucht, daran zu erinnern, dass quellenuntersuchungen nicht wie mathematische exempel anzufassen sind, wo durch einführung x und y eine glatte lösung zu erzielen sind. Ueber ihren textkritischen und sprachlichen bestrebungen scheint die philologie es bisweilen zu vergessen, dass die historischen werke des alterthums nicht blosse überlieferte texte, sondern literarische erzeugnisse von individuen mit fleisch und blut sind.“ Schlumberger, Epitome de Caesaribus, 57 hebt zu Recht hervor, dass Enmann „mit unbestechlichem Scharfblick und philologischem Einfühlungsvermögen“ vorgeht. Unklar ist, welche Teile der Untersuchungen Enmanns Chastagnol, Histoire Auguste, LXX meint: „Enmann la (nämlich die Kaisergeschichte) reconstituait d’une manière certes logique, mais un peu aventureuse.“
12Dessau, Über Zeit und Persönlichkeit. Zur Frage des Enddatums der EKG s. den letzten Abschnitt dieser Abhandlung.
13 Vgl. die Diskussion unter III.1.
14 Ich habe mich dabei bemüht, alle Fälle nach dem weiter unten entwickelten System zu berücksichtigen, bin mir aber bewußt, dass einige Fälle übersehen worden sein können. Zuweisungen zur EKG, für die es keine Begründung in der Übereinstimmung von Textzeugen gibt, sind entsprechend der Anwendung des Ökonomieprinzips nicht berücksichtigt.
15 S. bereits Dessau, Über Zeit und Persönlichkeit, 361 zur Zahl der gemeinsamen Fehler: „dass Commodus den Monat September nach sich habe benennen lassen, dass Didius Iulianus an dem Tode des Pertinax Schuld gewesen sei, dass auch Clodius Albinus sich daran betheiligt habe, dass Pescennius Niger bei Cyzicus seinen Tod gefunden habe, dass Iulia Domna die Stiefmutter des Caracalla gewesen sei, dass der Sohn des Macrinus Diadumenus geheissen habe, dass Maximinus bei Aquileja von Pupienus getödtet worden sei, dass Gordian III der Sohn des ersten gewesen sei, während der zweite überhaupt nicht erwähnt wird, dass der gallische Usurpator Marius nur zwei Tage regiert habe.“ Zum Commodus-September s. jedoch Kommentar zu fr. 40.
17 Vgl. fr. 47.
18 Die Usurpation Nigers ging von Syrien aus, Victor macht aus Niger dagegen einen dux Aegypti, da er die Machtergreifung des Severus in Syrien lokalisiert: Bird, Strange Aggregate, 98. Eine Erklärung für den Fehler bei Birley, Further notes, 20–7.
19 Vgl. Hdn. 3,4,6; Cass. Dio 74,8,3 und Amm. 26,8,15 (Tötung in der Umgebung von Antiocheia), s. dazu Dessau, Über Zeit und Persönlichkeit, 361; Bird, Strange Aggregate, 98; Birley, Further notes, 20–7.
20 Vgl. Kommentar zu fr. 43.
21 Vgl. Kommentar zu fr. 44.
22Eutr. 8,20,1 = Aur. Vict. 21,3.
23 Vgl. fr. 104.
24 Vgl. fr. 68.
25 Vgl. fr. 71.
26 Vgl. fr. 105.
27 Vgl. Barnes, Lost Kaisergeschichte, 19. S. fr. 116.
28 Vgl. Barnes, Lost Kaisergeschichte, 19 f. S. fr. 125.
29 So Chastagnol, Histoire Auguste, LXX. Chastagnol beruft sich dabei auf Beobachtungen zur Darstellung der Geschichte des Didius Iulianus und des gallischen Usurpators Marius, vgl. dazu fr. 44 und fr. 86.
30 Vgl. auch Hier. chron. 227a: post X annos.
31 S. zu Eutrop Bleckmann, Kommentar zu Eutr. 9,22,2 (KFHist B 3, 263).
32 Vgl. auch zu Aur. Vict. 39,34 f.; Eutr. 9,25,1 und Ruf. Fest. 25,2 f. (vgl. fr. 109); Barnes, Lost Kaisergeschichte, 18.
33 So Manuwald, Sonderreich, 18. Der von Manuwald genannte analoge Fall, in dem bald Eutrop (9,8,2), bald Aurelius Victor (33,3) mehr hat, ist völlig anders gelagert, da hier ein gemeinsamer Kontext und gemeinsamer Duktus erhalten geblieben ist, vgl. fr. 83 a und d.
34 Besonders auffällig sind die Übereinstimmungen zwischen Hist. Aug. Sept. Sev. 17,5–19,5 und Aur. Vict. 20,1–30, vgl. auch Aur. Vict. 20,33 f. und Hist. Aug. Carac. 8,1. Zur Frage Birley, Further notes, 34–6; Chastagnol, L’utilisation des „Caesares“; Chausson, Severus; M. Festy, Aurélius Victor, source de l’Histoire Auguste et de Nicomaque Flavien, in: F. Paschoud (Hg.), HAC Genevense (1998), Bari 1999, 121–33; Hohl, Die Historia Augusta und die Caesares, reagiert auf H. Stern, Date et destinataire de l’Histoire Auguste, Paris 1953 und seine Behandlung von Aur. Vict. 20,1–31 und Hist. Aug. Sept. Sev. 17,5–19,4. S. bereits Dessau, Über Zeit und Persönlichkeit, 361.
35 Zu Gemeinsamkeiten zwischen Eutrop und der Historia Augusta und zur möglichen Benutzung: T. Damsholt, Zur Benutzung von dem Breviarum des Eutrop in der Historia Augusta, C&M 25 (1964) 138–50; Schmid, Eutropspuren; Fündling, Vita Hadriani, 144 f. Das Vorliegen einer fehlerhaften frühen Handschrift Eutrops könnte erklären, dass die Historia Augusta einen sonst nicht bekannten Usurpator Trebellianus aufführt, vgl. Eutr. 9,8,1 mit Zinsli, Vita Heliogabali, 85.
36 Enmann, 379: „sieht theilweise wie aus Eutrop abgeschrieben aus“.
37 A. Lippold, Kommentar zur Vita Maximini duo, Bonn 1991, 110–21. Wenn die EKG allerdings erst nach 357 fertig gestellt worden ist, kann der von Lippold in die diokletianisch-konstantinische Zeit datierte Autor der Historia Augusta nur eine Vorgängerfassung benutzt haben. Zum Problem s. Barnes, Lost Kaisergeschichte, 42: “Hence the HA’s use of KG is no barrier to accepting its purported date, only if an independent proof is first provided of the Diocletianic or Constantinian date of the KG.”
38Chastagnol, L’utilisation des „Caesares“; Chastagnol, Histoire Auguste, LXX. Ein Aurelius Victor wird in Hist. Aug. Opil. 4,2 explizit genannt, mit dem Cognomen Pinius; die Historia Augusta kennt auch einen Festus (Opil. 4,4). Vgl. A. von Domaszewski, Die Personennamen bei den Scriptores historiae Augustae, Heidelberg 1918, 114.
39 Vgl. auch fr. 90 und zu Hist. Aug. Sev. 17,5–19,4 die Untersuchung von Chausson, Severus, 4.
40 Im Fettdruck die Passagen, die sich in der Hist. Aug. (Aurelian. / trig. tyr.) fast identisch wiederfinden.
41 Einige Fälle, in denen Entlehnungen aus Eutrop, Aurelius Victor oder der gemeinsamen Quelle wahrscheinlich sind, wurden insbesondere beim Fehlen wörtlicher Bezüge nicht berücksichtigt. So findet sich der in Mailand ermordete Valerian, der Bruder des Gallienus, von dem Eutr. 9,11,1 berichtet, in Hist. Aug. Gall. 14,9–11 sowie Valer. 8,1 wieder. Die Historia Augusta (Alex. 24,4) kannte das auch bei Aurelius Victor erwähnte Verbot männlicher Prostituierter durch Philippus Arabs (Aur. Vict. 28,7). Hist. Aug. Gord. 15,6 lässt sich als Attacke auf Aur. Vict. 27,1 (der junge Gordian als Prätorianerpräfekt) verstehen. Hist. Aug. Ael. 2,2 und Aur. Vict. 13,12 nennen Aelius als ersten Caesar. Hist. Aug. Comm. 5,5 und Aur. Vict. 17,4 ähneln sich in Details zum Gladiatorenkampf.
42 Vgl. Fündling, Vita Hadriani, 138 f. zur parallelen Benutzung von EKG einerseits und den Breviatoren andererseits. Ein „Entweder-Oder“ gibt es hier – anders als früher angenommen – wohl nicht. Fündling, 139 zitiert zustimmend Syme, Emperors, 123: „The author had on his desk the KG, Victor and Eutropius. He consulted each of them from time to time as need or whim dictated.”
43 Vgl. fr. 52.
44Dessau, Über Zeit und Persönlichkeit, 366.
45 S. auch Chausson, Severus, 112.
46 Vgl. Enmann, 399 f., z. B. Eutr. 8,14,1 = Epit. Caes. 16,8: hic permisit viris clarioribus, ut convivia eodem cultu, quo ipse, et ministris similibus exhiberent. (Enmann, 400). Die Benutzung nimmt ab Mark Aurel deutlich zu (Enmann, 404). Bis Kapitel 11 benutzt der Autor der Epitome immer wieder (zunehmend ab Caligula) wörtlich Aurelius Victor, vgl. Enmann, 401–4. Enmanns Ergebnisse wurden durch die Quellenstudie von Schlumberger, Epitome de Caesaribus, 17–62 bestätigt.
47 Dies gilt auch dann, wenn Übereinstimmungen nur zwischen Eutrop, Hieronymus und der Epitome de Caesaribus festzustellen sind. Burgess, Jerome, 366 rechnet beispielsweise folgenden (bereits von Helm, Hieronymus und Eutrop, 206) diskutierten Fall als Beleg für die EKG: Hier. chron. 232a: Constantinus uxorem suam Faustam interfecit. Eutr. 10,6,3: Constantinus … interfecit … uxorem. Epit. Caes. 41,11 f.: at Constantinus … uxorem suam Faustam … interemit. So wie die Passagen von Burgess zitiert und ausgewählt sind, haben Hieronymus und die Epitome de Caesaribus dem Eutrop inhaltlich nichts voraus. Die einzige zusätzliche Angabe besteht darin, dass Hieronymus und die Epitome de Caesaribus den Namen der Fausta erwähnen. Da Fausta aber in Eutrop 10,3,2 genannt wird, ist nicht auszuschließen, dass Hieronymus seine Informationen auch hier aus Eutrop hat.
48 Die Gleichsetzung der EKG mit dem Suetonius auctus wird auch sonst in der Regel akzeptiert. Vgl. Barnes, Lost Kaisergeschichte, 14 f.; Burgess, Jerome, 350 mit Anm. 6; Festy, Pseudo-Aurélius Victor, XXI. S. hierzu unten S. 24–9.
49Schlumberger, Epitome de Caesaribus, 56.
50 Vgl. z. B. Aur. Vict. 34,3 und Epit. Caes. 34,3. Nur die Epitome de Caesaribus kennt hier den Namen des Pomponius Bassus.
51 Vgl. z. B. Hist. Aug. Hadr. 1,1 f. und Epit. Caes. 14,1; Epit. Caes. 18,4 und Hist. Aug. Pert. 12,1 und 13,5 mit Schlumberger, Epitome de Caesaribus, 110. Zur Alexanderimitatio Caracallas bei Marius Maximus s. Schlumberger, 118. Besonders deutlich sind die Übereinstimmungen in der langen Parallele von Epit. Caes. 23,6 f. und Hist. Aug. Heliog. 17,1–3 sowie 17,5 zur Behandlung des Leichnams Elagabals, einer Parallele, die Schlumberger, 122 f. als „Prunkstück der Quellenkritik“ wertet. Die Epitomepassage: huius corpus per urbis vias more canini cadaveris a militibus tractum est militari cavillo appellantibus indomitae rabidaeque libidinis catulam. novissime, cum angustum foramen cloacae corpus minime reciperet, usque ad Tiberim deductum adiecto pondere, ne unquam emergeret, in fluvium proiectum est. vixit annos XVI atque ex rebus, quae acciderant, Tiberinus Tractitiusque appellatus est. Die Historia Augusta schreibt: post hoc in eum impetus factus est atque in latrina, ad quam confugerat, occisus. Tractus deinde per publicum. addita iniuria cadaveri est, ut id in cloacam milites mitterent. Sed cum non cepisset cloaca fortuito, per pontem Aemilium adnexo pondere, ne fluitaret, in Tiberium abiectum est, ne umquam sepeliri posset. Tractum est cadauer eius etiam per circi spatia, priusquam in Tiberim praecipitaretur … appellatus est post mortem Tiberinus et Tractatitius et Inpurus et multa.
52 Hierzu zähle ich auch die Ausführungen über die vinolentia Traians, in denen sich Übereinstimmungen zwischen Aurelius Victor, der Epitome de Caesaribus und der Historia Augusta zeigen, vgl. Aur. Vict. 13,10; Epit. Caes. 13,4 und 48,3; Hist. Aug. Hadr. 3,3. Zu den Parallelen s. Schlumberger, Epitome de Caesaribus, 83 sowie Fündling, Vita Hadriani, 332–4 (mit Diskussion der Bezüge zu Marius Maximus).
53 Z. B. Epit. Caes. 16,5 f.; Eutr. 8,10,3 f.; Hist. Aug. Aur. 14,8 und Hist. Aug. Ver. 9,11. Vgl. auch Eutr. 8,11–4; Epit. Caes. 16,7–10; Hist. Aug. Aur. 16,5 und 17,4–6 mit Schlumberger, Epitome de Caesaribus, 101.
54Schlumberger, Epitome de Caesaribus, 102 f.
55Eutr. 9,8 f. und Eutr. 9,20–8.
56Eus. chron. (armenische Fassung) p. 217 Karst (a. 2097).
57Eus. chron. (armenische Fassung) p. 217 Karst (a. 2099).
58 Eine so gut wie völlige Abhängigkeit des Hieronymus von Eutrop hatte Th. Mommsen, Über die Quellen der Chronik des Hieronymus [1850], in: ders., Gesammelte Schriften 7, Berlin 1909, 606–32, angenommen. Zu den Ausnahmen gehören nach Mommsen einige von Hieronymus übernommene Passagen des Rufius Festus. Nuancierter (mit der Annahme der Benutzung des Aurelius Victor) dagegen bereits A. Schöne, Die Weltchronik des Eusebius in ihrer Bearbeitung durch Hieronymus, Berlin 1900, 205–23. Barnes, Lost Kaisergeschichte, 21, Anm. 50 geht noch davon aus, dass „the standard view seems to be that Jerome never consulted the KG“. Auf den hochwichtigen Beitrag von Helm, Hieronymus und Eutrop, der diese „standard view“ seit langem obsolet gemacht hatte, verweist dagegen Barnes, Sources, 94. Burgess, Jerome, 350 f. nimmt Helm auf und hat die Absicht, abschließend zu zeigen „that Helm was correct in concluding that Jerome used the KG when composing the Chronici canones.“ Der eigene Aufsatz wird beschrieben als „simply an expansion and revision of the imperial material in Helm’s paper.“ Burgess, 369 beendet seinen Aufsatz mit der Feststellung, dass die EKG kein Phantom ist und es an der Zeit ist, Zweifel an ihrer Existenz beiseite zu schieben und die Forschung voranzutreiben: „We may now put aside talk of phantoms of nineteenth-century German scholarship and move forward.“ Etwas anders wird dann das Verhältnis zwischen Helm und Burgess bei Burgess, A Common Source, 166 beschrieben. Burgess stellt zunächst die Aufsätze von Mommsen und Helm einander gegenüber: „A better and more acute analysis appeared in 1927 from the pen of Rudolf Helm (…), but it is long and involved (and written in German), and therefore often overlooked.“ Es werden dann die von Burgess auf Burgess zurückgeführten Fortschritte („important advances“) bei der Analyse der Quellen des Hieronymus hervorgehoben, nämlich hinsichtlich der Benutzung der Descriptio consulum, der Continuatio Antiochiensis sowie der EKG: „(…) refinements have been made to the proof that he used the Kaisergeschichte.“
59 Vgl. fr. 90 mit Kommentar.
60Ruf. Fest. 24,1: Aureliani imperatoris gloriae Zenobia, Odenathi uxor, accessit: ea enim post mortem mariti feminea dicione Orientis tenebat imperium: quam Aurelianus multis clibanariorum et sagittariorum milibus fretam apud Immas haut procul ab Antiochia vicit et captam Romae triumphans ante currum duxit. Die Historia Augusta hat (Aurelian. 22,1): Zenobia … orientale tenebat imperium.
61Helm, Hieronymus und Eutrop, 150–66; 268–77. Übereinstimmungen auch in wenigen Passagen für die Geschichte nach 357, dem Endpunkt der durch die Gemeinsamkeiten von Aurelius Victor und Eutrop definierten EKG, vgl. Helm, 300–3.
62Helm, Hieronymus und Eutrop, 304 gibt die „Vermutung“ Enmanns wieder, „dass einmal ein Corpus einer Latina historia existiert hat, welches die römische Geschichte von den Albanerkönigen bis zur neuesten Zeit in biographischer Form enthalten hätte.“ Der republikanische Teil war aus Livius abgeleitet, der kaiserzeitliche wurde dann durch die EKG dargestellt. Ob die EKG vielleicht selbst auch die Geschichte der Republik erfasste, lässt Helm, 304 offen. Deutlich in diesem Sinne Burgess, A Common Source, 190. Zum Einsetzen der EKG mit Augustus s. die überzeugenden Argumente bei Rohrbacher, Enmann’s „Kaisergeschichte“, 709–14.
63Helm, Hieronymus und Eutrop, 146–55; 159–65; 269–77. S. auch die allgemeinen Betrachtungen bei Helm, Hieronymus und Eutrop, 303–5. Die Kaisergeschichte ist daher eher mittelbar benutzt, nämlich über den Autor, der Republik- und Kaisergeschichte miteinander verbunden hat. De facto ist allerdings im Einzelfall der Unterschied zwischen einer direkten und einer indirekten Benutzung nicht nachweisbar, wie Helm, 304 f. betont: „Ob es nun die ursprüngliche ‚Kaisergeschichte‘ oder vielmehr erst eine darauf fussende Darstellung war, bleibt sich gleich.“
64 Ein Beispiel bietet Eutr. 9,4: post hos Decius e Pannonia inferiore, Budaliae natus imperium sumpsit. filium suum Caesarem fecit. Hier. chron. 218c ist hier völlig parallel: Decius e Pannonia inferiore Budaliae natus fuit. Durch den zusätzlichen Zeugen Aurelius Victor ist aber sicher, dass die EKG auf jeden Fall über die Herkunft des Decius berichtete, vgl. Aur. Vict. 29,1: at Decius, Sirmiensium vico ortus, militiae gradu ad imperium conspiraverat, laetiorque hostium nece filium Etruscum nomine Caesarem facit. Der Tenor der EKG kann damit ermittelt werden, ganz gleich, ob Hieronymus seine Version Eutrop oder der EKG verdankt.
65 S. oben 18.
66 S. Helm, Hieronymus und Eutrop, 260. Kein Pendant bei Aurelius Victor, daher nicht in die EKG-Fragmente aufgenommen. Das gilt für eine Reihe weiterer im Folgenden aufgeführter Parallelen.
67Helm, Hieronymus und Eutrop, 277 f.: Eutrop ist nicht Quelle von Hieronymus, weil dieser Sueton besser entspricht und zu der „Form lavaretur und zu der Bezeichnung purpureus zurückkehrt”.
68 Vgl. dazu Helm, Hieronymus und Eutrop, 278: „Gegenüber der Darstellung bei E. [Eutrop] ist die Betonung des plurimam partem beachtenswert, die allenfalls in der Erzählung des Sueton und dem immensus numerus ihre Begründung findet, aber nicht im Eutroptext.“
69 Hieronymus zeigt größere Nähe zu Suet. Dom. 13,2: statuas sibi in Capitolio non nisi aureas et argenteas poni permisit ac ponderis certi. Vgl. Helm, Hieronymus und Eutrop, 260: „Der Ausdruck kehrt mit dem Plural und der Verbindung sibi in Capitolio wieder zu dem suetonischen zurück.“ Vgl. Burgess, Jerome, 358. Im Gegenzug soll Nerva die Errichtung goldener und silberner Statuen verboten haben, vgl. Cass. Dio 68,2,1: „Er verbot auch, ihm zu Ehren goldene oder silberne Standbilder zu errichten.“ (Übers. Veh). Die Nachricht geht also letztlich auf antidomitianische Propaganda nach dem Regierungswechsel von 96 zurück. Auch bei Cassius Dio wird der Plural gebraucht.
70 fr. 1. Vgl. die Erläuterungen im Kommentar.
71 Zu weiteren Übereinstimmungen für den gesamten Abschnitt bei Eutrop und bei Sueton s. Schlumberger, Epitome de Caesaribus, 20.
72 Vgl. Cohn, Quibus ex fontibus, 37.
73 Vgl. Cohn, Quibus ex fontibus, 38.
74Helm, Hieronymus und Eutrop, 296.
75 Anders hier wieder Helm, Hieronymus und Eutrop, 296 f.
76 Dazu Bleckmann, Überlegungen, 20–4.
77 Zur Gegenüberstellung von Theophanes und Aurelius Victor vgl. Bleckmann, Überlegungen, 22: a) Theophn. p. 17,21 f. (de Boor) und Aur. Vict. 41,13 (Erhebung des Constans); b) Theophn.. p. 20,20 und 41,9 (de Boor) (Kooptation des Martinianus); c) Theophn. p. 20,21 (de Boor) und Aur. Vict. 41,6 (die drei Caesaren von 317); d) Theophn. p. 27,31–28,2 (de Boor) und Aur. Vict. 41,13 (Goten- und Sarmatensieg); e) Theophn. p. 28,19 f. (de Boor) und Aur. Vict. 41,18 (Donaubrücke von 328); f) Theophn. p. 29,28 (de Boor) und Aur. Vict. 41,15 (Erhebung des Dalmatius); g) Theophn. p. 29,28–30 (de Boor) und Aur. Vict. 41,11 (Calocaerus in Zypern). Dazu gehört auch die Nachricht über den jüdischen Aufstand, vgl. Hier. chron. 238f; Aur. Vict. 42,11. In der Chronik des Hieronymus finden sich die Punkte a), c), d), f) und g), einige Punkte sind auch in syrischen Chroniken aufgegriffen. Zur EKG zählt diese Übereinstimmungen dagegen Burgess, Jerome, 367 (Constans und Calocaerus); 368 (jüdischer Aufstand unter Gallus). Ich vermute, dass Theophanes hier den gleichen Traditionsstrang von Fastennachrichten benutzt hat, den man auch für das fünfte Jahrhundert aufgrund naher Parallelen mit den Consularia Italica ermittelt hat, vgl. Mommsen, Chronica Minora I, 298 Anm. 2; 299 Anm. 1; 300 Anm. 1–2; 304 Anm. 1–2; 305 Anm. 2–3; 306 Anm. 1–3. Eine gesonderte Untersuchung der Frage bereite ich vor.
78 In wenigen Fällen können präzise chronologische Angaben auf die EKG, nicht etwa auf eine Fastenquelle zurückgeführt werden. Das gilt etwa für die Angaben zur Chronologie des britannischen Sonderreichs (Aur. Vict. 39,39–42, vgl. Eutr. 9,22,2). Bei den Angaben zur Chronologie der Kriege zwischen Konstantin und Licinius (Aur. Vict. 41,2 und 6) fehlt dagegen eine Parallele bei Eutrop.
79Wagener, Eutropius, 523–45.
80 Dazu Burgess, Jerome, 357: „Jerome and Festus both state that Egypt became a province, while Eutropius merely states that it was added to the Empire.“ Die Nachricht stammt letztlich aus Suet. Aug. 18,2.
81 Vgl. fr. 1.
82 Direkte Abhängigkeit von der EKG nimmt Burgess, Principes cum tyrannis, 491–500, besonders 494 an.
83 Zu diesen Beziehungen zwischen Polemius und dem Anonymus Valesianus vgl. König, Anonymus Valesianus I, 25.
84 Für die Kaisergeschichte stellt Mosshammer, Praefatio, XXIX fest: „nonnulla autem, quae pariter ab Eutropio narrata non invenimus, similiter commemorata inveniuntur in libro de Caesaribus, apud Orosium et scriptores historiae Augustae.“
85Bleckmann, Überlegungen, 18 f.
86 Vgl. Kommentar zu fr. 25, 67, 71, 79, 90, 91, 93, 98, 99.
87 Mosshammer, Praefatio, XXIX zu Gaius Caesar als Claudius Caesar. Vgl. Syncell. p. 326,27 mit Eutr. 2,14,4 zum Einsatz des Cornelius Lentulus. Der durchaus bekannte Konsul von 275 v. Chr. besiegte in Wirklichkeit die Samniten.
88 Aus diesem Grund stimmt Synkellos manchmal auch allein mit Festus überein, etwa bei der Benennung von Gaius Caesar als Claudius Caesar. Vgl. Kommentar zu fr. 2 g. S. ferner zu Immae als Ort der Auseinandersetzung zwischen Zenobia und Aurelian fr. 90 g.
89 A. Schenk Graf von Stauffenberg, Die römische Kaisergeschichte bei Malalas. Griechischer Text der Bücher IX–XII und Untersuchungen, Stuttgart 1931; L. Mecella, Malalas und die Quellen für die Zeit der Soldatenkaiser, in L. Carrara u. a. (Hgg.), Die Weltchronik des Johannes Malalas. Quellenfragen, Stuttgart 2017, 73–98, hier 84–6.
90 C. de Boor, Zu Iohannes Antiochenus, Hermes 30 (1885) 321–30, hier 324–7. Mango / Scott, The Chronicle of Theophanes Confessor, lxxvi spricht irrig von zwei griechischen Eutropübersetzungen. Explizit weist die Suda (κ 342) dem Kapiton Lykios allerdings die Autorschaft einer Eutropübersetzung zu. Kritik an der These von Kapiton Lykios als Autor der bei Johannes Antiochenus vorliegenden Übersetzung bei U. Roberto, Il Breviarium di Eutropio nella cultura greca tardoantica e bizantina: la versione attribuita a Capitone Licio, MEG 3 (2003) 241–70. Zur Frage s. auch die abweichenden, allerdings m. E. kaum überzeugenden Ansichten von Cameron, The Last Pagans of Rome, 665–8.
91 Vgl. fr. 21, 69, 71, 72, 108, 111.
92 G. Zecchini, L’Origo Constantini imperatoris, in: ders., Richerche di storiografia latina tardoanticha (I), Rom 1993, 28–38. Zu dieser These vgl. M. Festy, Réflexions sur l’Origo Constantini Imperatoris (Anonymi Valesiani Pars Prior), in: G. Bonamente / M. Mayer (Hgg.), HAC Barcinonense (2002), Bari 2005, 181–93, hier 186 mit Anm. 19.
93 Vgl. fr. 115.
94 Zu dieser Parallele vgl. König, Anonymus Valesianus I, 22; Neri, Medius princeps, 74.
95 Vgl. hierzu Neri, Medius princeps, 75 f. Zu Berührungen der Origo Constantini mit Hieronymus s. die Diskussion bei Barnes, Jerome.
96 Vgl. den Überblick bei König, Anonymus Valesianus I, 22–4.
97 S. zu Hadrian: Origo Rom. 49 (KFHist B 5): templum Romae et Veneris fabricatum est. Vgl. Hier. chron. 200d: templum Romae et Veneris sub Hadriano in urbe factum. Es findet sich keine entsprechende Notiz bei Eutrop, da 8,7,2 zu unbestimmt ist und sich auch auf provinziale Bautätigkeit beziehen kann, anders Burgess, Jerome, 359. S. dagegen Helm, Hieronymus und Eutrop, 156: „Bei E. [Eutrop] ist keine Unterlage dafür gegeben.“ Ferner zu Commodus: Origo Rom. 53 (KFHist B 5): hoc imperante thermae Commodianae dedicatae sunt. Vgl. Hier. chron. 208i: Thermae Commodianae Romae factae. Auch hier findet sich keine entsprechende Notiz bei Eutrop. Ähnliches lässt sich auch für die Bauwerke des Septimius Severus konstatieren: Origo Rom. 56 (KFHist B 5): hoc imperante Septizonium et thermae Severianae dedicatae sunt. Vgl. Hier. chron. 212a: Severo imperante thermae Severianae aput Antiochiam et Romae factae et Septizonium extructum. S. ferner Hist. Aug. Sept. Sev. 19,5. Zu Heliogabal: Origo Rom. 60 (KFHist B 5): Heliogabalium dedicatum est. Vgl. Hier. chron. 214g: Heliogabalium templum Romae aedificatum. S. Hist. Aug. Heliog. 1,6.
98KFHist B 5, 61.
99Helm, Hieronymus und Eutrop, 278. Vgl. auch ibid., 157 und 284. Mit zu berücksichtigen ist in der Diskussion die Historia Augusta (Alex. 25,3): opera veterum principum instauravit, ipse nova multa constituit, in his thermas nominis sui iuxta eas quae Neronianae fuerunt aqua inducta, quae Alexandrina nunc dicitur. Vgl. dazu Cohn, Quibus ex fontibus, 39 Anm. 37 gegen Mommsen (in Anmerkungen der Ausgabe Droysens). Eutrop soll nach Mommsen die Passage aus der Origo gentis Romanorum bezogen haben. Diese Möglichkeit lehnt Cohn ab: „Thermas enim a Nerone exstructas (7,15,2) si ex chronico (p. 647) hauserit, qui quaeso factum est, ut cum Lampridio (vit. Alex. 25) multo etiam magis concineret?“
100Helm, Hieronymus und Eutrop, 156–8; 280 f.; Burgess, Jerome, 357 f.; Stein, Einl. zu Origo Rom. (KFHist B 5, 18). Sehr knapp Barnes, Lost Kaisergeschichte, 23 f.
101 Auch die Benennung des Kaisers als Heliogabalus scheint für die gemeinsame Quelle von EKG und Origo gentis Romanorum spezifisch zu sein, s. Kommentar zu fr. 63.
102 In einigen Fällen stimmen die Origo gentis Romanorum, die Chronik Eusebs und die EKG miteinander überein. Übereinstimmungen zwischen Hieronymus, der armenischen Übersetzung der Chronik Eusebs und der Origo verweisen wohl immer darauf, dass Hieronymus seine Notiz nicht über die EKG, sondern über die Chronik des Euseb bezogen hat, vgl. die Nachricht über den Tod des Commodus in domo Vestiliani (Hier. chron. 210a), vgl. Origo Rom. 53 (KFHist B 5): excessit domo Victiliana und armenische Übersetzung p. 155 und p. 223 Karst. Im Falle von Altinum als Sterbeort des Lucius Verus, vgl. Origo Rom. 51: excessit Altino. Für fr. 33 (Tod des Lucius Verus in Altinum) findet sich eine Parallele nicht nur bei den Zeugen der EKG (vgl. fr. 33), sondern auch in der armenischen Übersetzung der Chronik Eusebs p. 155 Karst: „Beros verschied zu Latinos“. Der gleiche Befund ist für weitere Todesortnachrichten zu konstatieren. Zu Antoninus Pius vgl. etwa Origo Rom. 50 (KFHist B 5): excessit Lorio mit fr. 31 und der armenischen Übersetzung p. 155 Karst, für den Todesort Caracallas vgl. Origo Rom. 58 (KFHist B 5): excessit inter Edessam et Carras mit fr. 61 und der armenischen Übersetzung p. 155 und 225 Karst.
103 S. auch R. Behrwald, Die Stadt als Museum? Die Wahrnehmung der Monumente Roms in der Spätantike, Berlin 2009, 241.
104 Ein Beispiel wäre etwa die Nachricht über die Errichtung des Roma und Venus-Tempels durch Hadrian, vgl. Kommentar zu fr. 28.
105 Vgl. M.-P. Arnaud-Lindet, Introduction, in: Orose. Histoire contre les païens. Tome I: Livres I–III, Paris 2003, XXIX.
106 A. Alföldi, Die verlorene Kaisergeschichte Enmanns und die „Caesares“ Julians, in: BHAC 1966/1967, Bonn 1968, 1–8. Gegen dessen Hypothese wendet Barnes, Lost Kaisergeschichte, 27 Anm. 80 ein, die Ähnlichkeiten zwischen Julian und den Zeugen der EKG erklärten sich durch die gleiche Faktengrundlage.
107Iul. caes. 313 b. Vgl. fr. 84.
108Iul. caes. 313 d. Vgl. fr. 87.
109Iul. caes. 313 d. Vgl. fr. 91 und 92.
110Iul. caes. 315 b–c und fr. 112 und 117. Die Wollust wird bei Aur. Vict. 39,46 thematisiert. Zur Schaffung der Provinz Dakien durch Traian vgl. Iul. caes. 311 c und fr. 22.
111Iul. caes. 314 a–b. Vgl. Hist. Aug. Prob. 15,3. Eine Gegenüberstellung von weiteren Stellen der Historia Augusta und des Zosimos einerseits mit Passagen aus Julian andererseits bei Schmidt, Eusebius, 634 f. Einige wörtliche Übereinstimmungen zwischen Julian und Zosimos könnten sich allerdings daraus erklären, dass Zosimos über Eunapios Formulierungen Julians widerspiegelt (im Sinne der Hypothesen von A. Baldini, Ricerche sulla Storia di Eunapio di Sardi, Problemi di storiografia tardopagana, Bologna 1984 zum ersten Buch des Zosimos, s. auch A. Baldini, Le due edizioni della Storia di Eunapio e le fonti della Storia Nuova di Zosimos, AFLM 19 [1986] 47–109).
112Iul. caes. 312 c, vgl. dagegen fr. 41. Macrinus ist in der EKG anders als bei Iul. caes. 313 a nicht der Mörder des Caracalla gewesen, vgl. fr. 61 mit Kommentar.
113 Enmann, 422.
114 S. Ratti, Jérôme et Nicomaque Flavien: Sur les sources de la Chronique pour les années 357–364, Historia 46,4 (1997) 479–508; ders., Les sources de la Chronique pour les années 357–364: Nouveaux éléments, in: B. Pouderon / Y.-M. Duval (Hgg.), L’historiographie de l’Eglise des premiers siècles, Paris 2001, 425–50. Ratti hat später dann andere Vorstellungen zu Nicomachus Flavianus entwickelt.
115Burgess, A Common Source, 190.
116Helm, Hieronymus und Eutrop, 300–3.
117Helm, Hieronymus und Eutrop, 304.
118 Möglicherweise nur eine Eigenart Eutrops.
119 fr. 67; fr. 111.
120 Vgl. fr. 32; 35; 52; 82; 102; 123; 132.
121 fr. 13; 28; 35; 49; 50. Eine ganze Reihe weiterer sonstiger Notizen zum Bildungsstand der Kaiser, die sich entweder bei Aurelius Victor oder bei Eutrop finden, dürfte ebenfalls der EKG entstammen.
122 fr. 86; 90; 103; 105.
123 fr. 83 und 86 zu den Usurpationen in der Zeit des Gallienus.
124 fr. 90. Zum Suetonius auctus s. oben III. 2 und 3b.
125 Zu dem mit vielen Unsicherheiten behafteten Marius Maximus s. Fündling, Vita Hadriani, 102–18; Zinsli, Vita Heliogabali, 78–83.
126 fr. 44.
127Bleckmann, Überlegungen, 29 f. mit Verweis auf Paneg. 8,10,1 f.
128 Vgl. zu Enmann, 435 Bleckmann, Überlegungen, 33.
129 fr. 88: Dass Claudius Gothicus der Ahnherr der konstantinischen Dynastie war, wurde anscheinend auch in der EKG behauptet.
130 Enmann, 434. Vgl. hierzu Bleckmann, Überlegungen, 35.
131 fr. 108 und 109.
132 fr. 115. Zu den Leistungen Konstantins für den Schutz Galliens Eutr. 10,3,2.
133 fr. 119. Zur Verantwortung Konstantins für den im Sinne der Rettung Roms notwendigen Angriff B. Bleckmann, Constantine, Rome, and the Christians, in: Wienand, Contested Monarchy, 309–29, hier 321–4.
134 Dazu passt auch, dass sich zahlreiche Übereinstimmungen zwischen der EKG und der unmittelbar nach 325 abgeschlossenen Origo gentis Romanorum feststellen lassen, s. oben IV. 2.
135 Insbesondere wurde die ungünstige Charakterisierung des Maximianus Herculius nicht mehr korrigiert, obwohl dieser der Großvater des Constantius II. war.
136 Abweichende Überlegungen zum Redaktionsdatum der EKG bei Barnes, Lost Kaisergeschichte, 20, der keine spezifischen Ähnlichkeiten und Bindefehler für die Zeit nach 337 sieht. Ich selbst habe (Überlegungen, 36) wegen der Betonung der „Verteidigungsleistungen (…) des Constantius und des jungen Constantin“ in Verbindung mit der Kritik an der Alleinherrschaft Konstantins die Epoche des Magnentius erwogen, im Korrekturzusatz aber für das Enddatum 357 bereits auf Burgess, Jerome und auf Burgess, On the Date aufmerksam gemacht. Zu diesem Datum s. bereits H. W. Bird, Further Observations on the Dating of Enmann’s Kaisergeschichte, CQ 90 (1973) 375–7 sowie Syme, Emperors, 222. Auch der ursprüngliche Ansatz Enmanns, der seine Kaisergeschichte wegen der damaligen Annahmen zur Datierung der Historia Augusta in die tetrarchisch-konstantinische Zeit datierte, für die Zeit nach der Tetrarchie bis 357 dann einen Fortsetzer annehmen musste, legt diesen zeitlichen Ansatz (357) nahe. Man kann also für die EKG deutlich erkennen, dass es eine erste Formung in der tetrarchisch-konstantinischen Zeit gibt, dass aber die Endredaktion in die 350er Jahre gehört. Wenn man diese Formungsstufen im Blick hat und gleichzeitig berücksichtigt, wie Enmanns zeitlicher Ansatz (aufgrund des damals angenommenen Datums der Redaktion der Historia Augusta) zustande kommen musste, kann von einer großen Bandbreite der Datierung der EKG (von der Tetrarchie bis zu Constantius II.) und von einer völligen Verschiebung der Hypothesen zu ihrer Entstehungszeit keine Rede sein. Dies ist einzuwenden gegen die grundsätzliche Kritik von Zecchini, Qualche ulteriore riflessione, 66: „è mia ferma opinione che, quando un metodo d’indagine richiede il continuo spostamento del terminus ad quem per la fonte-base di una tradizione storiografica e soprattutto crede di risolvere le difficoltà attraverso fonti-fantasma, ebbene questo metodo è sbagliato.“ Den Bedenken von Zecchini folgt Gnoli, Aureliano, 39, der ebenfalls von einer Spreizung der mutmaßlichen Entstehungszeit von den 280er bis zu den 350er Jahren ausgeht.
137 fr. 127.
138 fr. 129; 131; 132.
139 fr. 132; Iul. ad Ath. 271 d.
140 fr. 124.
141 fr. 126.
142 fr. 104. Vgl. Iul. ad Ath. 270 c–d.
-
fr.
1
ohne Stellenangabe
fr. 2 ohne Stellenangabe
fr. 3 ohne Stellenangabe
fr. 4 ohne Stellenangabe
fr. 5 ohne Stellenangabe
fr. 6 ohne Stellenangabe
fr. 7 ohne Stellenangabe
fr. 8 ohne Stellenangabe
fr. 9 ohne Stellenangabe
fr. 10 ohne Stellenangabe
fr. 11 ohne Stellenangabe
fr. 12 ohne Stellenangabe
fr. 13 ohne Stellenangabe
fr. 14 ohne Stellenangabe
fr. 15 ohne Stellenangabe
fr. 16 ohne Stellenangabe
fr. 17 ohne Stellenangabe
fr. 18 ohne Stellenangabe
fr. 19 ohne Stellenangabe
fr. 20 ohne Stellenangabe
fr. 21 ohne Stellenangabe
fr. 22 ohne Stellenangabe
fr. 23 ohne Stellenangabe
fr. 24 ohne Stellenangabe
fr. 25 ohne Stellenangabe
fr. 26 ohne Stellenangabe
fr. 27 ohne Stellenangabe
fr. 28 ohne Stellenangabe
fr. 29 ohne Stellenangabe
fr. 30 ohne Stellenangabe
fr. 31 ohne Stellenangabe
fr. 32 ohne Stellenangabe
fr. 33 ohne Stellenangabe
fr. 34 ohne Stellenangabe
fr. 35 ohne Stellenangabe
fr. 36 ohne Stellenangabe
fr. 37 ohne Stellenangabe
fr. 38 ohne Stellenangabe
fr. 39 ohne Stellenangabe
fr. 40 ohne Stellenangabe
fr. 41 ohne Stellenangabe
fr. 42 ohne Stellenangabe
fr. 43 ohne Stellenangabe
fr. 44 ohne Stellenangabe
fr. 45 ohne Stellenangabe
fr. 46 ohne Stellenangabe
fr. 47 ohne Stellenangabe
fr. 48 ohne Stellenangabe
fr. 49 ohne Stellenangabe
fr. 50 ohne Stellenangabe
fr. 51 ohne Stellenangabe
fr. 52 ohne Stellenangabe
fr. 53 ohne Stellenangabe
fr. 54 ohne Stellenangabe
fr. 55 ohne Stellenangabe
fr. 56 ohne Stellenangabe
fr. 57 ohne Stellenangabe
fr. 58 ohne Stellenangabe
fr. 59 ohne Stellenangabe
fr. 60 ohne Stellenangabe
fr. 61 ohne Stellenangabe
fr. 62 ohne Stellenangabe
fr. 63 ohne Stellenangabe
fr. 64 ohne Stellenangabe
fr. 65 ohne Stellenangabe
fr. 66 ohne Stellenangabe
fr. 67 ohne Stellenangabe
fr. 68 ohne Stellenangabe
fr. 69 ohne Stellenangabe
fr. 70 ohne Stellenangabe
fr. 71 ohne Stellenangabe
fr. 72 ohne Stellenangabe
fr. 73 ohne Stellenangabe
fr. 74 ohne Stellenangabe
fr. 75 ohne Stellenangabe
fr. 76 ohne Stellenangabe
fr. 77 ohne Stellenangabe
fr. 78 ohne Stellenangabe
fr. 79 ohne Stellenangabe
fr. 80 ohne Stellenangabe
fr. 81 ohne Stellenangabe
fr. 82 ohne Stellenangabe
fr. 83 ohne Stellenangabe
fr. 84 ohne Stellenangabe
fr. 85 ohne Stellenangabe
fr. 86 ohne Stellenangabe
fr. 87 ohne Stellenangabe
fr. 88 ohne Stellenangabe
fr. 89 ohne Stellenangabe
fr. 90 ohne Stellenangabe
fr. 91 ohne Stellenangabe
fr. 92 ohne Stellenangabe
fr. 93 ohne Stellenangabe
fr. 94 ohne Stellenangabe
fr. 95 ohne Stellenangabe
fr. 96 ohne Stellenangabe
fr. 97 ohne Stellenangabe
fr. 98 ohne Stellenangabe
fr. 99 ohne Stellenangabe
fr. 100 ohne Stellenangabe
fr. 101 ohne Stellenangabe
fr. 102 ohne Stellenangabe
fr. 103 ohne Stellenangabe
fr. 104 ohne Stellenangabe
fr. 105 ohne Stellenangabe
fr. 106 ohne Stellenangabe
fr. 107 ohne Stellenangabe
fr. 108 ohne Stellenangabe
fr. 109 ohne Stellenangabe
fr. 110 ohne Stellenangabe
fr. 111 ohne Stellenangabe
fr. 112 ohne Stellenangabe
fr. 113 ohne Stellenangabe
fr. 114 ohne Stellenangabe
fr. 115 ohne Stellenangabe
fr. 116 ohne Stellenangabe
fr. 117 ohne Stellenangabe
fr. 118 ohne Stellenangabe
fr. 119 ohne Stellenangabe
fr. 120 ohne Stellenangabe
fr. 121 ohne Stellenangabe
fr. 122 ohne Stellenangabe
fr. 123 ohne Stellenangabe
fr. 124 ohne Stellenangabe
fr. 125 ohne Stellenangabe
fr. 126 ohne Stellenangabe
fr. 127 ohne Stellenangabe
fr. 128 ohne Stellenangabe
fr. 129 ohne Stellenangabe
fr. 130 ohne Stellenangabe
fr. 131 ohne Stellenangabe
fr. 132 ohne Stellenangabe
fr. 133 ohne Stellenangabe
Erklärung der Siglen, Zeichen und Abkürzungen in Text und Apparat
Erklärung der Zeichen in der Übersetzung
fr. 1
a) Eutr. 7,7: Aegyptus per Octavianum Augustum imperio Romano adiecta est. 7,9: Romano adiecit imperio Aegyptum, Cantabriam, Dalmatiam … Pannoniam, Aquitaniam, Illyricum, Raetiam, Vindelicos et Salassos in Alpibus.
b) Hier. chron. 162h: Aegyptus fit Romana provincia.
c) Ruf. Fest. 13,3: Aegyptus … provinciae formam Octaviani Caesaris Augusti temporibus accepit.
d) Aur. Vict. 1,2: adiectis imperio civium Raetis Illyricoque.
e) Epit. Caes. 1,7: Cantabros et Aquitanos, Raetos, Vindelicos, Dalmatas provinciarum numero populo Romano coniunxit.
fr. 2
a) Eutr. 7,9: obsides, quod nulli antea, Persae ei dederunt. 7,10,1: Scythae et Indi, quibus antea Romanorum nomen incognitum fuerat, munera et legatos ad eum miserunt.
b) Hier. chron. 164e: Indi ab Augusto per legatos amicitiam postularunt.
c) Ruf. Fest. 19,3: pacatis gentibus Orientis Augustus Caesar etiam Indorum legationem primus accepit.
d) Aur. Vict. 1,7: felix adeo … ut Indi, Scythae, Garamantes ac Bactri legatos mitterent orando foederi.
e) Epit. Caes. 1,8: huic Persae obsides obtulerunt creandique reges arbitrium permiserunt. 1,9: ad hunc Indi, Scythae, Garamantes, Aethiopes legatos cum donis miserunt.
g) Syncell. 376,6 sq.: τότε καὶ Πανδίων ὁ τῶν Ἰνδῶν βαϲιλεὺϲ ἐπεκηρυκεύϲατο φίλοϲ Αὔγουϲτου γενέϲθαι καὶ ϲύμμαχοϲ.
fr. 3
a) Eutr. 7,11,2: quosdam reges ad se per blanditias evocatos numquam remisit, in quibus Archelaum Cappadocem, cuius etiam regnum in provinciae formam redegit et maximam civitatem appellari nomine suo iussit, quae nunc Caesarea dicitur, cum Mazaca antea vocaretur.
b) Hier. chron. 172c: Tiberius multos reges ad se per blanditias evocatos numquam remisit, in quibus et Archelaum Cappadocem, cuius regno in provinciam verso Mazacam nobilissimam civitatem Caesariam appellari iussit.
c) Ruf. Fest. 11,4: (semper inter auxilia nostra fuere Cappadoces et ita maiestatem coluere Romanam), ut in honorem Augusti Caesaris Mazaca, civitas Cappadociae maxima, Caesarea cognominaretur. postremo sub imperatore Claudio Caesare cum Archelaus rex Cappadocum Romam venisstet et ibi diu detentus occubuisset, in provinciae speciem Cappadocia migravit.
d) Aur. Vict. 2,3: nihilque praeter Cappadocas idque inter exordia in provinciam subactum remoto rege Archelao.
g) Lyd. mag. 3,57,2: Καιϲάρειαν τὴν πόλιν Τιβέριοϲ Καῖϲαρ μετωνόμαϲεν, Ἀρχέλαον τῶν Καππαδοκῶν βαϲιλέα δόλῳ μεταϲτειλάμενοϲ ἐν τῇ Ῥώμῃ καὶ καταϲχὼν ἐν αὐτῇ· τὴν δὲ Καππαδοκίαν, οὐκ οὖϲαν ἄνωθεν, πρῶτοϲ ἐπαρχίαν Ῥωμαίοιϲ ἀπόφορον ἀπέφηνεν.
fr. 4
a) Eutr. 7,12,3: stupra sororibus intulit.
b) Hier. chron. 178g: (sorores), quibus stuprum intulerat.
d) Aur. Vict. 3,10: quin etiam sororum stupro ac matrimoniis illudens nobilibus deorum habitu incedebat.
fr. 5
a) Eutr. 7,13,2 sq.: Britanniae intulit bellum, quam nullus Romanorum post C. Caesarem attigerat, eaque devicta per Cn. Sentium et A. Plautium, inlustres ac nobiles viros, triumphum celebrem egit. quasdam insulas etiam ultra Britannias in Oceano positas imperio Romano addidit, quae appellantur Orchades.
b) Hier. chron. 179g: Claudius de Brittanis triumphavit et Orchadas insulas Romano adiecit imperio.
d) Aur. Vict. 4,2: simul ultima occasus, Britanniae partes contusae, quam solam adiit Ostia profectus mari. nam cetera duces curavere.
fr. 6
a) Eutr. 7,14,5: duae tamen sub eo provinciae factae sunt, Pontus Polemoniacus concedente rege Polemone et Alpes Cottiae Cottio rege defuncto.
b) Hier. chron. 184b: duae tantum provinciae sub Nerone factae, Pontus Polemoniacus et Alpes Cottiae Cottio rege defuncto.
d) Aur. Vict. 5,2: quo etiam Pontum in ius provinciae Polemonis permissu redegit, cuius gratia Polemoniacus Pontus appellatur, itemque Cottias Alpes Cottio rege mortuo.
f) Hist. Aug. Aurelian. 21,11: Nero, sub quo Pontus Polemoniacus et Alpes Cottiae Romano nomini sunt tributae.
fr. 7
a) Eutr. 7,15,1: cum quaereretur ad poenam … e palatio fugit et in suburbano liberti sui, quod est inter Salariam et Nomentanam viam ad quartum urbis miliarium, se interfecit. 7,15,3: obiit tricesimo et altero aetatis anno … atque in eo omnis Augusti familia consumpta est.
b) Hier. chron. 185h: Nero cum a senatu quaereretur ad poenam, e palatio fugiens ad quartum urbis miliarium in suburbano liberti sui inter Sala-
riam et Nomentanam viam semet interficit anno aetatis XXXII atque in eo omnis Augusti familia consumpta est.
d) Aur. Vict. 5,16: verum eius (sc. Galbae ) adventu desertus undique nisi ab spadone, … semet ictu transegit, cum implorans percussorem diu ne ad mortem quidem meruisset cuiusquam officium. 5,17: hic finis Caesarum genti fuit.
e) Epit. Caes. 5,7: ubi adventare Nero Galbam didicit senatusque sententia constitutum … egressus urbe sequenti … sequentibus Phaone, Epaphrodito Neophyotque et spadone Sporo … semet ictu gladii transegit, adiuvante trepidantem manum impuro de quo diximus eunucho.
g) Pol. Silv. princ. 8: Nero … ipse se ferro, cum ob scelera sua et dedecora, quibus genus hominum omne superavit, a Romano populo ad poenam quaereretur, occidit.
Syncell. 414,16–18: οὗτοϲ εἰϲ Ῥώμην ἐπανελθὼν ἐκ τῆϲ Ἑλλάδοϲ ἐκεῖθεν πάλιν εἰϲ Ἄργον φεύγει πειραϲθεὶϲ ἐπαναϲτάϲεωϲ καὶ ὑπό τινοϲ τῶν οἰκετῶν βιαίωϲ ἀναιρεῖται, ὡϲ δὲ ἕτεροι, ἑαυτὸν διαχειριϲάμενοϲ τέθνηκεν.
fr. 8
a) Eutr. 7,16,1: antiquissimae nobilitatis senator. 7,16,2: huius breve imperium fuit et quod bona haberet exordia, nisi ad severitatem propensior videretur.
d) Aur. Vict. 6,1: haud secus nobilis e gente clarissima Sulpiciorum, ubi Romam ingressus est, quasi luxuriae aut etiam crudelitati auxilio ventitavisset, rapere trahere vexare ac foedum in modum vastare cuncta et polluere.
fr. 9
a) Eutr. 7,18,4: interfecto prius in urbe Sabino Vespasiani imperatoris fratre, quem cum Capitolio incendit.
d) Aur. Vict. 8,5: huius legatorum in Italiam transgressu fusisque apud Cremonam suis Vitellius ab Sabino urbi praefecto, Vespasiani fratre,
sestertium milies pepigerat arbitris militibus imperio decedere. sed postquam mox circumventum se nuntio ratus est, quasi renovato furore ipsum ceterosque adversae partis cum Capitolio, quod remedium saluti ceperant, cremavit.
g) Syncell. 416,8–15: οὗτοϲ Ϲαβῖνον τὸν ἀδελφὸν Οὐεϲπαϲιανοῦ διατρίβοντα κατὰ τὴν Ῥώμην καὶ φόβῳ τῆϲ ἀναρρήϲεωϲ τοῦ ἀδελφοῦ ἐν τῷ Καπετωλίῳ προϲφυγόντα κατὰ τὸν ναὸν τοῦ Διὸϲ ἀνεῖλε, πολιορκήϲαϲ τὸν ἄνδρα καὶ τὸν ναὸν ἐμπρήϲαϲ.
fr. 10
a) Eutr. 7,19,1: princeps obscure quidem natus, sed optimis conparandus, privata vita inlustris.
d) Aur. Vict. 8,4: quippe Vespasianus nova senator familia Reatinis maioribus industria rebusque pacis ac militiae longe nobilis habebatur.
fr. 11
a) Eutr. 7,19,2: Romae se in imperio moderatissime gessit.
d) Aur. Vict. 9,2 sq.: namque primum satellites tyrannidis, nisi qui forte atrocius longe processerant, flectere potius maluit quam excruciatos delere prudentissime ratus nefaria ministeria a pluribus metu curari. deinde coniurationum multas scelere inulto abscedere patiebatur, comiter uti erat stultitiae coarguens, qui ignorarent, quanta moles molestiaque imperio inesset.
fr. 12
a) Eutr. 7,19,3 sq.: sub hoc Iudaea Romano accessit imperio et Hierosolyma, quae fuit urbs nobilissima Palaestinae. Achaiam, Lyciam, Rhodum, Byzantium, Samum, quae libera ante id tempus fuerant, item Thraciam, Ciliciam, Commagenen, quae sub regibus amicis egerant, in provinciarum formam redegit.
b) Hier. chron. 188c: Achaia Lycia Rhodus Byzantium Samus Thracia Cilicia Commagene, quae liberae antea et sub regibus amicis erant, in provincias redactae.
d) Aur. Vict. 9,10: at bello rex Parthorum Vologaesus in pacem coactus atque in provincia Syria, cui Palaestinae nomen, Iudaeique.
e) Epit. Caes. 9,13: Syria, cui Palaestina nomen est, Ciliciaque Trachia et Commagene, quam hodie Augustophratensem nominamus, provinciis accessere. Iudaei quoque additi sunt.
fr. 13
a) Eutr. 7,21,1: facundissimus … causas Latine egit, poemata et tragoedias Graece conposuit. 7,21,3: liberalitatis tantae fuit, ut … cum quadam die in cena recordatus fuisset nihil se illo die cuiquam praestitisse, dixerit: amici, hodie diem perdidi.
b) Hier. chron. 189a: Titus filius Vespasiani in utraque lingua disertissimus fuit et tantae bonitatis, ut, cum quadam die recordatus fuisset in cena nihil se in illo die cuiquam praestitisse, dixerit: amici, hodie diem perdidi.
d) Aur. Vict. 10,1: ceterum Titus postquam imperium adeptus est, incredibile quantum, quem imitabatur, anteierit, praesertim litteris clementiaque ac muneribus.
e) Epit. Caes. 10,9: quadam etiam die recordans vesperi nihil se illo die cuiquam praestitisse venerando caelestique dicto „amici“, ait, „hodie perdidimus diem“; quod erat magnificae liberalitatis.
fr. 14
a) Eutr. 7,22,1: periit in ea, qua pater, villa post biennium et menses octo, dies viginti, quam imperator erat factus, aetatis anno altero et quadragesimo.
b) Hier. chron. 189g: Titus morbo perit in ea villa qua pater anno aetatis XLII.
d) Aur. Vict. 10,5: ita biennio post ac menses fere novem … interiit.
e) Epit. Caes. 10,15: vixit annos XLI, et in eodem quo pater apud Sabinos agro febri interiit.
fr. 15
a) Eutr. 7,23,1: primis tamen annis moderatus in imperio fuit.
d) Aur. Vict. 11,3: sed Domitianus primo clementiam simulans.
fr. 16
a) Eutr. 7,23,4: expeditiones quattuor habuit … adversum Cattos, duas adversum Dacos.
d) Aur. Vict. 11,4: Dacis et Cattorum manu devictis.
fr. 17
a) Eutr. 7,23,5: Romae quoque multa opera fecit, in his Capitolium et forum transitorium, divorum porticus, Iseum ac Serapeum et stadium.
b) Hier. chron. 191a: multa opera Romae facta, in quis Capitolium, forum transitorium, divorum porticus, Isium et Sarapium, stadium, horrea piperataria, Vespasiani templum, Minerva Chalcidica, Odium, forum Traiani, thermae Traianae et Titianae, senatus, ludus matutinus, mica aurea, meta sudans et Pantheum.
d) Aur. Vict. 11,4: multaque operum inchoata per patrem vel fratris studio atque in primis Capitolium absolvit. 13,5: adhuc Romae a Domitiano coepta forum atque alia multa plus quam magnifice coluit ornavitque (sc. Traianus).
e) Epit. Caes. 11,3: Romae multa aedificia vel coepta vel a fundamentis construxit.
fr. 18
a) Eutr. 7,23,2: interfecit nobilissimos e senatu.
d) Aur. Vict. 11,5: atrox caedibus bonorum.
fr. 19
a) Eutr. 7,23,2: dominum se et deum primus appellari iussit.
b) Hier. chron. 190h: primus Domitianus dominum se et deum appellari iussit.
d) Aur. Vict. 11,2: maior libidinum flagitio ac plus quam superbe utens patribus, quippe qui se dominum deumque dici coegerit.
fr. 20
a) Eutr. 7,23,6: interfectus est suorum coniuratione in palatio anno aetatis quadragesimo quinto, imperii quinto decimo. funus eius ingenti dedecore per vespillones exportatum et ignobiliter est sepultum.
b) Hier. chron. 192g: Domitianus occisus in Palatio et per vispillones ignobiliter exportatus.
d) Aur. Vict. 11,7 sq.: libertorum consilio, uxore non ignara … poenas luit quinto et quadragesimo vitae anno, dominationis circiter quintodecimo. at senatus gladiatoris more funus ferri … decrevit.
fr. 21
a) Eutr. 8,2,1: successit ei Ulpius Crinitus Traianus natus Italicae in Hispania, familia antiqua magis quam clara. nam pater eius primum consul fuit. imperator autem apud Agrippinam in Galliis factus est. rem publicam ita administravit, ut omnibus principibus merito praeferatur, inusitatae civilitatis et fortitudinis.
b) Hier. chron. 193e: Traianus Agrippinae in Gallis imperator factus natus Italicae in Hispania.
fr. 22
a) Eutr. 8,2,2: Daciam Decibalo victo subegit, provincia trans Danubium facta in his agris, quos nunc Taifali, Victohali et Tervingi habent.
b) Hier. chron. 194b: Traianus victo rege Decibalo Daciam fecit provinciam.
c) Ruf. Fest. 8,2: Traianus Dacos sub rege Decibalo vicit et Daciam trans Danubium in solo barbariae provinciam fecit.
d) Aur. Vict. 13,3: quippe primus aut solus etiam vires Romanas trans Istrum propagavit domitis in provinciam Dacorum pileatis †satisque† nationibus Decibalo rege ac †Sardonios†. 33,3: amissa trans Istrum, quae Traianus quaesiverat.
fr. 23
a) Eutr. 8,3,1 sq.: Hiberorum regem et
Sauromatarum et Bosphoranorum et Arabum et Osdroenorum et Colchorum in fidem
accepit. Carduenos, Marcomedos occupavit et Anthemusium, magnam Persidis
regionem.
Seleuciam, Ctesiphontem, Babylonem. Messenios vicit ac tenuit usque ad
Indiae fines et mare rubrum accessit atque ibi tres provincias fecit,
Armeniam, Assyriam, Mesopotamiam.
b) Hier. chron. 194b: Traianus … Hiberos Sauromatas Osroenos Arabas Bosforanos Colchos in fidem accepit, Seleuciam Ctesifontem Babylonem occupavit et tenuit. in mari Rubro classem instituit, ut per eam Indiae fines vastaret. 196b: Traianus Armeniam Assyriam Mesopotamiam fecit provincias.
c) Ruf. Fest. 14,3: per Traianum Armenia, Mesopotamia, Assyria et Arabia provinciae factae sunt. 20,2 sq.: Traianus … Hiberos, Bosphorianos, Colchos in fidem Romanae dicionis recepit. Osrhoneorum loca et Arabum occupavit. Carduenos, Marcomedos obtinuit, Anthemusium optimam Persidis regionem, Seleuciam, Ctesiphontem, Babyloniam accepit ac tenuit. usque ad Indiae fines … accessit. in mari rubro classem instituit. provincias fecit Armeniam, Mesopotamiam, Assyriam.
d) Aur. Vict. 13,3: simul ad ortum solis cunctae gentes, quae inter Indum et Euphratem amnes inclitos sunt, contusae {cui} bello.
fr. 24
a) Eutr. 8,4: Romae et per provincias aequalem se omnibus exhibens, amicos salutandi causa frequentans vel aegrotantes vel cum festos dies habuissent, convivia cum isdem indiscreta vicissim habens, saepe in vehiculis eorum sedens, nullum senatorum laedens.
d) Aur. Vict. 13,8: aequus, clemens, patientissimus atque in amicos perfidelis.
fr. 25
a) Eutr. 8,5,2: e Perside rediens apud Seleuciam Isauriae profluvio ventris extinctus est. obiit autem aetatis anno sexagesimo tertio, mense nono, die quarto.
b) Hier. chron. 197a: Traianus morbo in Selinunti perit sive, ut alibi scriptum repperimus, apud Seleuciam Isauriae profluvio ventris extinctus est.
d) Aur. Vict. 13,11: rogatu patrum Italiam repetens morbo periit grandaeva aetate.
g) Syncell. 425,13 sq.: Τραϊανὸϲ νόϲῳ τελευτᾷ κατ’ Εὐϲέβιον ἐν Ϲελινοῦντι, κατὰ δὲ ἄλλουϲ ἐν Ϲελευκείᾳ τῆϲ Ἰϲαυρίαϲ δυϲεντερίᾳ.
fr. 26
a) Eutr. 8,6,1: defuncto Traiano Aelius Hadrianus creatus est princeps, sine aliqua quidem voluntate Traiani, sed operam dante Plotina Traiani uxore; nam eum Traianus, quamquam consobrinae suae filium, vivus noluerat adoptare. natus et ipse Italicae in Hispania.
b) Hier. chron. 197b: Hadrianus Italicae in Hispania natus consobrinae Traiani filius fuit.
d) Aur. Vict. 13,11: ascito prius ad imperium Hadriano civi propinquoque. 13,13: quamquam alii Plotinae, Traiani coniugis, favore imperium assecutum putent, quae viri testamento heredem regni institutum simulaverat.
f) Hist. Aug. Hadr. 4,10: nec desunt qui factione Plotinae mortuo iam Traiano Hadrianum in adoptionem adscitum esse prodiderint, supposito qui pro Traiano fessa voce loquebatur.
fr. 27
a) Eutr. 8,6,2: Traiani gloriae invidens statim provincias tres reliquit, quas Traianus addiderat, et de Assyria, Mesopotamia, Armenia revocavit exercitus.
b) Hier. chron. 197d: Traiani invidens gloriae de Assyria Mesopotamia Armenia, quas ille provincias fecerat, revocavit exercitus.
c) Ruf. Fest. 14,4: Hadrianus … invidens Traiani gloriae sponte sua Armeniam, Mesopotamiam, Assyriam reddidit. 20,3: Hadrianum gloriae Traiani certum est invidisse. qui … revocatis exercitibus Armeniam, Mesopotamiam, Assyriam concessit.
f) Hist. Aug. Hadr. 5,3: quare omnia trans Eufraten ac Tigrim reliquit. 9,1: multas provincias a Traiano adquisitas relinquit.
fr. 28
a) Eutr. 8,7,2: facundissimus Latino sermone, Graeco eruditissimus fuit.
b) Hier. chron. 197g: Hadrianus eruditissimus in utraque lingua, sed in puerorum amore parum continens fuit.
f) Hist. Aug. Hadr. 14,8 sq.: fuit enim poematum et litterarum nimium studiosissimus. … in voluptatibus nimius. nam et de suis dilectis multa versibus composuit.
fr. 29
a) Eutr. 8,7,3: obiit in Campania maior sexagenario.
b) Hier. chron. 201f: Hadrianus morbo intercutis aquae aput Baias moritur maior sexagenario.
d) Aur. Vict. 14,12: apud Baias tabe interiit … senecta viridiore.
e) Epit. Caes. 14,12: vixit annos LXII.
f) Hist. Aug. Hadr. 25,6: apud ipsas Baias perit. 25,11: vixit annis LX[X]II.
fr. 30
a) Eutr. 8,8,1: ergo Hadriano successit T. Antoninus Fulvius Boionius, idem etiam Pius nominatus, genere claro, sed non admodum vetere, vir insignis et qui merito Numae Pompilio conferatur. 8,9,1: post hunc imperavit M. Antoninus Verus haud dubie nobilissimus, quippe cum eius origo paterna a Numa Pompilio, materna a Solentino rege penderet.
d) Aur. Vict. 15,1 sq.: at Aelio Antonino cognomentum Pii. hunc fere nulla vitiorum labes commaculavit. vir veterrimae familiae, e Lanuvino municipio, senator urbis. 16,1: namque M. Boionium, qui Aurelius Antoninus habetur, eodem oppido, pari nobilitate, … in familiam atque imperium ascivit.
e) Epit. Caes. 15,1: Antoninus Fulvius seu Boionius dictus, postea etiam Pius cognominatus. 15,2 sq.: tantae bonitatis in principatu fuit, ut haud dubie sine exemplo vixerit, quamvis eum Numae contulerit aetas sua.
Hist. Aug. Pius 2,2: in cunctis postremo laudabilis et qui merito Numae Pompilio ex bonorum sententia conparatur.
fr. 31
a) Eutr. 8,8,4: obiit apud Lorium villam suam miliario ab urbe duodecimo, vitae anno septuagesimo tertio.
b) Hier. chron. 204a: Antoninus Pius aput Lorium villam suam XII ab urbe miliario moritur anno vitae LXXVII.
e) Epit. Caes. 15,7: apud Lorios villa propria, milibus passuum duodecim ab urbe febri … consumptus est.
fr. 32
a) Eutr. 8,9,2–10,1: tumque primum Romana res publica duobus aequo iure imperium administrantibus paruit, cum usque ad eum singulos semper habuisset Augustos. hi et genere inter se coniuncti fuerunt et adfinitate. nam Verus Annius Antoninus M. Antonini filiam in matrimonium habuit, M. autem Antoninus gener Antonini Pii fuit per uxorem Galeriam Faustinam iuniorem, consobrinam suam.
b) Hier. chron. 204b: hi primum aequo iure imperium administraverunt, cum usque ad hoc tempus singuli Augusti fuerint.
c) Ruf. Fest. 21,1: Antonini duo Marcus et Verus, hoc est socer et gener, pariter Augusti, imperium orbis aequata primum potestate.
d) Aur. Vict. 16,3: fratrem Lucium Verum in societatem potentiae accepit.
e) Epit. Caes. 16,5: is propinquum suum Lucium Annium Verum ad imperii partem novo benivolentiae genere ascivit.
f) Hist. Aug. Aur. 7,5 sq.: fratrem sibi participem in imperio designavit, quem Lucium Aurelium Verum Commodum appellavit Caesaremque atque Augustum dixit. atque ex eo pariter coeperunt rem publicam regere. tuncque primum Romanum imperium duos Augustos habere coepit, ⟨***⟩ lictum cum alio participasset.
g) Amm. 27,6,16: nec enim quisquam antehac asciuit sibi pari potestate collegam praeter principem Marcum, qui Verum adoptiuum fratrem absque diminutione aliqua auctoritatis imperatoriae socium fecit.
fr. 33
a) Eutr. 8,10,2: hi bellum contra Parthos gesserunt. … Verus Antoninus ad id profectus est. qui Antiochiae et circa Armeniam agens multa per duces suos et ingentia patravit. Seleuciam Assyriae urbem nobilissimam cum quadringentis milibus hominum cepit; Parthicum triumphum revexit, cum fratre eodemque socero triumphavit.
b) Hier. chron. 204f: Seleucia Assyriae urbs cum CCC milibus hominum a Romanis capta.
c) Ruf. Fest. 21,1: sed ex his Antoninus iunior ad expeditionem Parthicam profectus est; multa et ingenia adversus Persas feliciter gessit; Seleuciam, Assyriae urbem, cum quadringentis milibus hostium cepit, ingenti gloria de Persis cum socero triumphavit.
f) Hist. Aug. Aur. 12,8: petitque Lucius, ut secum Marcus triumpharet.
fr. 34
a) Eutr. 8,10,3 sq.: (Verus Antoninus) obiit tamen in Venetia, cum a Concordia civitate Altinum proficisceretur et cum fratre in vehiculo sederet, subito sanguine ictus casu morbi, quem Graeci apoplexin vocant … cum obisset undecimo imperii anno. 8,11,1: post eum M. Antoninus solus rem publicam tenuit.
b) Hier. chron. 205k: Lucius imperator anno regni nono sive ut quidam putant XI inter Concordiam et Altinum apoplexi extinctus est sedens cum fratre in vehiculo.
d) Aur. Vict. 16,5–9: Lucius paucis diebus moritur hincque materies fingendi dolo consanguinei circumventum. quem ferunt, cum invidia gestarum rerum angeretur, fraudem inter cenam exercuisse. namque lita veneno cultri parte vulvae frustum, quod de industria solum erat, eo praecidit consumptoque uno, uti mos est inter familiares, alterum, qua
virus contigerat, germano porrexit. haec in tanto viro credere nisi animi ad scelus proni non queunt. quippe cum Lucium satis constet Altini, Venetiae urbe, morbo consumptum.
e) Epit. Caes. 16,5: qui Verus inter Altinum atque Concordiam iter faciens, ictu sanguinis, quem morbum Graeci apoplexin vocant, undecimo imperii anno extinctus est. 16,7: post cuius obitum Marcus Antoninus rem publicam solus tenuit.
f) Hist. Aug. Aur. 14,8: postquam iter ingressi sunt, sedens cum fratre in vehiculo Lucius apoplexi arreptus perit. 15,5: nemo est principum, quem non gravis fama perstringat, usque adeo ut etiam Marcus in sermonem venerit, quod Verum vel veneno ita tulerit, ut parte cultri veneno lita vulvam inciderit venenatam partem fratri edendam propinans et sibi innoxiam reservans. Ver. 9,11: sed non longe ab Altino subito in vehiculo morbo, quem apoplexin vocant, correptus Lucius depositus e vehiculo detracto sanguine Altinum perductus … apud Altinum perit. Ver. 11,1: imperavit cum fratre annis undecim. Aur. 16,3: post Veri obitum Marcus Antoninus solus rem publicam tenuit.
fr. 35
a) Eutr. 8,11,1 sq.: a principio vitae tranquillissimus, adeo ut ex infantia quoque vultum nec ex gaudio nec ex maerore mutaverit. philosophiae deditus Stoicae, ipse etiam non solum vitae moribus, sed etiam eruditione philosophus. tantae admirationis adhuc iuvenis, ut eum successorem paraverit Hadrianus relinquere, adoptato tamen Antonino Pio generum ei idcirco esse voluerit, ut hoc ordine ad imperium perveniret.
d) Aur. Vict. 16,1: namque M. Boionium, qui Aurelius Antoninus habetur, eodem oppido, pari nobilitate, philosophandi vero eloquentiaeque studiis longe praestantem in familiam atque imperium ascivit.
f) Hist. Aug. Aur. 16,5–7: erat enim ipse tantae tranquillitatis, ut vultum nunquam mutaverit maerore vel gaudio, philosophiae deditus stoicae … nam et Hadrianus hunc eundem successorem paraverat, nisi ei aetas puerilis obstitisset. quod quidem apparet ex eo, quod generum Pio hunc eundem delegit, ut ad eum, dignum utpote virum, quandocumque Romanorum perveniret imperium.
fr. 36
a) Eutr. 8,12,2: nam eo gravius est factum (sc. bellum Marcomannicum), quod universi exercitus Romani perierant. sub hoc enim tantus casus pestilentiae fuit, ut post victoriam Persicam Romae ac per Italiam provinciasque maxima hominum pars, militum omnes fere copiae languore defecerint.
b) Hier. chron. 206h: tanta per totum orbem pestilentia fuit, ut paene usque ad internecionem Romanus exercitus deletus sit.
f) Hist. Aug. Aur. 13,3: tanta autem pestilentia fuit, ut vehiculis cadavera sint exportata serracisque. Aur. 17,2: eo quidem tempore, quo pestilentia gravis multa milia et popularium et militum interemerat.
fr. 37
a) Eutr. 8,12,2: provincias ingenti benignitate et moderatione tractavit. contra Germanos eo principe res feliciter gestae sunt, bellum ipse unum gessit Marcomannicum, sed quantum nulla memoria fuit, adeo ut Punicis conferatur. 8,13,1: ingenti ergo labore et moderatione, cum apud Carnuntum iugi triennio perseverasset, bellum Marcomannicum confecit, quod cum his Quadi, Vandali, Sarmatae, Suebi atque omnis barbaria commoverat. multa hominum milia interfecit ac Pannoniis servitio liberatis Romae rursus cum Commodo Antonino filio suo, quem iam Caesarem fecerat, triumphavit.
b) Hier. chron. 207e: Antoninus cum filio de hostibus triumphavit, quos per triennium apud Carnuntum habens stativa castra vastaverat.
d) Aur. Vict. 16,9: ut is Marcomannos cum filio Commodo, quem Caesarem suffecerat, petiturus. 16,13: triumphi acti ex nationibus, quae rege Marcomaro ab usque urbe Pannoniae, cui Carnunto nomen est, ad media Gallorum protendebantur.
f) Hist. Aug. Aur. 17,1–3: ergo provincias post haec ingenti moderatione ac benignitate tractavit. contra Germanos res feliciter gessit. speciale ipse bellum Marcomannicum, sed quantum nulla umquam memoria fuit, cum virtute tum etiam felicitate transegit, et eo quidem tempore,
quo pestilentia gravis multa milia et popularium et militum interemerat. Pannonias ergo Marcomannis, Sarmatis, Vandalis, simul etiam Quadis extinctis servitio liberavit et Roma cum Commodo, quem iam Caesarem fecerat, filio, ut diximus, suo, triumphavit.
fr. 38
a) Eutr. 8,13,2: ad huius belli sumptum cum aerario exhausto largitiones nullas haberet neque indicere provincialibus aut senatui aliquid vellet, instrumentum regii cultus facta in foro divi Traiani sectione distraxit, vasa aurea, pocula crystallina et murrina, uxoriam ac suam sericam et auream vestem, multa ornamenta gemmarum. ac per duos continuos menses ea venditio habita est multumque auri redactum. post victoriam tamen emptoribus pretia restituit, qui reddere conparata voluerunt; molestus nulli fuit, qui maluit semel empta retinere.
f) Hist. Aug. Aur. 17,4 sq.: cum autem ad hoc bellum omne aerarium exhausisset suum neque in animum induceret, ut extra ordinem provincialibus aliquid imperaret, in foro divi Traiani auctionem ornamentorum imperialium fecit vendiditque aurea pocula et cristallina et murrina, vasa etiam regia et vestem uxoriam sericam et auratam, gemmas quin etiam, quas multas in repostorio sanctiore Hadriani reppererat. et per duos quidem menses haec venditio celebrata est, tantumque auri redactum, ut reliquias belli Marcomannici ex sententia persecutus postea dederit potestatem emptoribus, ut, si qui vellet empta reddere[t] atque aurum recipere, sciret licere. nec molestus ulli fuit qui vel non reddidit empta vel reddidit.
fr. 39
a) Eutr. 8,14: hic permisit viris clarioribus, ut convivia eodem cultu, quo ipse, et ministris similibus exhiberent. in editione munerum post victoriam adeo magnificus fuit, ut centum simul leones exhibuisse tradatur. cum igitur fortunatam rem publicam et virtute et mansuetudine reddidisset, obiit XVIII imperii anno, vitae LXI, et omnibus certatim adnitentibus inter divos relatus est.
b) Hier. chron. 208a: Antoninus post victoriam adeo in editione munerum magnificus fuit, ut C simul leones exhibuerit.
d) Aur. Vict. 16,14 sq.: ita anno imperii octavo decimoque aevi validior Vendobonae interiit maximo gemitu mortalium omnium. denique, quae seiuncti in alias, patres ac volgus soli omnia decrevere, templa columnas sacerdotes.
f) Hist. Aug. Aur. 17,6–18,3: tunc viris clarioribus permisit, ut eodem cultu quo et ipse vel ministris similibus convivia exhiberent. in munere autem publico tam magnanimus fuit, ut centum leones una missione simul exhiberet sagittis interfectos. cum igitur in amore omnium imperasset atque ab aliis modo frater, modo pater, modo filius, ut cuiusque aetas sinebat, et diceretur et amaretur, octavo decimo anno imperii sui, sexagesimo et primo vitae, diem ultimum clausit. tantusque illius amor adeo die regii funeris claruit, ut nemo illum plangendum censuerit, certis omnibus, quod ab diis commodatus ad deos redisset. denique, priusquam funus conderetur, ut plerique dicunt, quod numquam antea factum fuerat neque postea, senatus populusque non divisis locis sed in una sede propitium deum dixit.
fr. 40
a) Eutr. 8,15: L. Antonius Commodus nihil paternum habuit, nisi quod contra Germanos feliciter et ipse pugnavit. Septembrem mensem ad nomen suum transferre conatus est, ut Commodus diceretur. sed luxuria et obscenitate depravatus gladiatoriis armis saepissime in ludo, deinceps etiam in amphitheatro cum huiusmodi hominibus dimicavit.
b) Hier. chron. 208f: Commodus de Germanis triumphavit. 208i: Thermae Commodianae Romae factae. 208k: Commodus Septembrem mensem nomine suo appellavit.
d) Aur. Vict. 17,2: bello plane impigre, quo in Quados prospere gesto Septembrem mensem Commodum appellaverat. 17,3: moenia … lavandi usui instituit. 17,4: immiti prorsus feroque ingenio, adeo quidem, uti gladiatores specie depugnandi crebro trucidaret, cum ipse ferro, obiecti mucronibus plumbeis uterentur.
e) Epit. Caes. 17,4: in tantum depravatus, ut gladiatoriis armis saepissime in amphitheatro dimicaverit.
f) Hist. Aug. Comm. 11,10: gladiatorium etiam certamen subiit. 11,11: ludum semper ingressus est.
fr. 41
a) Eutr. 8,15: obiit morte subita atque adeo, ut strangulatus vel veneno interfectus putetur, cum annis XII post patrem et VIII mensibus imperasset, tanta execratione omnium, ut hostis generis humani etiam mortuus iudicaretur.
b) Hier. chron. 210a: Commodus strangulatur (in domo Vestiliani).
d) Aur. Vict. 17,7–9: quidem primo occultatius veneno petivere anno regni tertio fere atque decimo. cuius ⟨vis⟩ frustrata per cibum, quo se casu repleverat. cum tamen alvi dolorem causaretur, auctore medico, principe factionis, in palaestram perrexit. ibi per ministrum ungendi (nam forte is quoque e consilio erat) faucibus quasi arte exercitii bracchiorum nodo validius pressis exspiravit. 17,10: senatus … simul plebes hostem deorum atque hominum radendumque nomen sanxere.
fr. 42
a) Eutr. 8,16: huic successit Pertinax grandaevus, ut qui septuagenariam attigisset aetatem, praefecturam urbi tum agens, ex senatus consulto imperare iussus.
b) Hier. chron. 210b: Pertinax septuagenario maior, cum praefecturam urbis ageret, ex senatus consulto imperare iussus est.
d) Aur. Vict. 17,10: confestimque praefecto urbi Aulo Helvio Pertinaci imperium defertur.
e) Epit. Caes. 18,2: praefecturam urbi agens imperator effectus … obtruncatur annos natus VII atque LX.
f) Hist. Aug. Pert. 4,8: Pertinax … sexagenario maior.
fr. 43
a) Eutr. 8,16: octogesimo die imperii praetorianorum militum seditione et Iuliani scelere occisus est. 8,18,4: sub eo etiam Clodius Albinus, qui in occidendo Pertinace socius fuerat Iuliano.
b) Hier. chron. 210e: Pertinax occiditur in Palatio Iuliani iuris periti scelere.
d) Aur. Vict. 18,2: eum milites … impulsore Didio, foede iugulavere octogesimo imperii die. 20,8–9: Clodium Albinum … Pertinacis auctor occidendi.
e) Epit. Caes. 18,1: Helvius Pertinax imperavit dies LXXXV. 18,2: scelere Iuliani multis vulneribus obtruncatur.
f) Hist. Aug. Did. 3,7: habebaturque ita, quasi Iuliani consilio esset Pertinax interemptus. Alb. 1,1: post Pertinacem, qui auctore Albino interemptus est. Alb. 14,2: apud Iulianum de occidendo Pertinace ipsius plurimum auctoritas valuerit. Alb. 14,6: quare Albinus occidendi Pertinacis Iuliano auctor fuit.
fr. 44
a) Eutr. 8,17: Salvius Iulianus rem publicam invasit, vir nobilis et iure peritissimus, nepos Salvii Iuliani qui sub divo Hadriano perpetuum conposuit edictum. victus est a Severo apud Mulvium pontem, interfectus in palatio.
b) Hier. chron. 210e: Iuliani iuris periti …, quem postea Severus apud Mulvium pontem interfecit. 200e: Salvius Iulianus perpetuum conposuit edictum.
d) Aur. Vict. 19,1: Didius an Salvius Iulianus … ex praefectura vigilum ad insignia dominatus processit. 19,2: genus ei pernobile iurisque urbani praestans scientia, quippe qui primus edictum, quod varie inconditeque a praetoribus promebatur, in ordinem composuerit. 19,4: namque eum … pontem proxime Mulvium acie devicit. missique, qui fugientem insequerentur, apud palatium Romae obtruncavere. 20,1: igitur Septimius
Pertinacis nece, simul flagitiorum odio, dolore atque ira commotior cohortes praetorias statim militia exemit cunctisque partium caesis Helvium senatus consulto inter divos refert. Salvii nomen atque eius scripta factave aboleri iubet.
e) Epit. Caes. 19,1: vir nobilis iure peritissimus. 19,3: ab hoc Severo Iulianus in abditas palatii balneas ductus extenta damnatorum modo cervice decollatur caputque eius in rostris ponitur.
f) Hist. Aug. sept. Sev. 17,5: victo et occiso Iuliano praetorianas cohortes exauctoravit. Pertinacem contra voluntatem militum in deos retulit. Salvii Iuliani decreta iussit aboleri; quod non obtinuit.
fr. 45
a) Eutr. 8,18,1–3: Septimius Severus … oriundus ex Africa provincia Tripolitana oppido Lepti. solus omnium memoria et ante et postea ex Africa imperator fuit. … Pertinacem se appellari voluit in honorem eius Pertinacis, qui a Iuliano fuerat occisus. parcus admodum fuit, natura saevus.
b) Hier. chron. 210f: Severus provincia Tripolitana oppido Lepti solus ex Africa usque in praesentem diem Romanus imperator fuit et in honorem Pertinacis, quem Iulianus occiderat, Pertinacem se cognominari iussit.
c) Ruf. Fest. 21,2: Severus, natione Afer.
d) Aur. Vict. 20,10: horum infinita caede crudelior habitus et cognomento Pertinax, quamquam ob vitae parsimoniam similem ipsum magis ascivisse plures putent; nobis mens ad credendum prona acerbitati impositum. 20,19: quin etiam Tripoli, cuius Lepti oppido oriebatur, bellicose gentes submotae procul.
f) Hist. Aug. Pert. 15,2: Pertinacis nomen accepit. Sept. Sev. 1,1 sq.: Severus Africa oriundus … cui civitas Lepti. Sept. Sev. 7,9: se quoque Pertinacem vocari iussit. Sept. Sev. 17,6: denique cognomentum Pertinacis non tam ex sua voluntate quam ex morum parsimonia videtur habuisse. Sept. Sev. 18,3: Tripolim, unde oriundus erat, contusis bellico-
sissimis gentibus securissimam reddidit ac p. R. diuturnum oleum gratuitum et fecundissimum in aeternum donavit.
fr. 46
a) Eutr. 8,18,2: hic primum fisci advocatus, mox militaris tribunus, per multa deinde et varia officia atque honores usque ad administrationem totius rei publicae venit.
d) Aur. Vict. 20,28 sq.: ortus medie humili, primo litteris, dehinc imbutus foro. quo parum commodante, uti rebus artis solet, dum tentat aut exquirit varia melioraque, imperium conscendit. ibi graviora expertus, laborem, curas, metum et incerta prorsus omnia, quasi testis vitae mortalium, „cuncta“, inquit, „fui, conducit nihil.“
fr. 47
a) Eutr. 8,18,4: Pescennium Nigrum, qui in Aegypto et Syria rebellaverat, apud Cyzicum interfecit. … sub eo etiam Clodius Albinus, qui in occidendo Pertinace socius fuerat Iuliano, Caesarem se in Gallia fecit victusque apud Lugdunum et interfectus.
d) Aur. Vict. 20,8 sq.: Pescennium Nigrum apud Cyzicenos, Clodium Albinum Lugduni victos coegit mori. quorum prior Aegyptum dux obtinens bellum moverat spe dominationis, alter, Pertinacis auctor occidendi, … in Gallia invaserat imperium.
f) Hist. Aug. sept. Sev. 9,1: dein conflixit cum Nigro eumque apud Cyzicum interemit. Pesc. 5,8: iterum pugnavit et victus est atque apud Cyzicum circa paludem fugiens sauciatus et sic ad Severum adductus atque statim mortuus.
fr. 48
a) Eutr. 8,18,4: bella multa et feliciter gessit. Parthos vicit et Arabas interiores et Adiabenos. Arabas eo usque superavit, ut etiam provinciam ibi faceret. idcirco Parthicus, Arabicus, Adiabenicus dictus est.
b) Hier. chron. 211e: Severus Parthos et Adiabenos superavit. Arabas quoque interiores ita cecidit, ut regionem eorum Romanam provinciam fecerit. ob quae Parthicus, Arabicus, Adiabenicus cognominatus est.
c) Ruf. Fest. 21,2: Severus … Parthos strenue vicit, Adiabenos delevit, Arabas interiores obtinuit et in Arabia provinciam fecit. huic cognomina ex victoriis quaesita sunt. nam Adiabenicus, Parthicus, Arabicus est cognominatus.
d) Aur. Vict. 20,14 sq.: felix ac prudens, armis praecipue adeo, ut nullo congressu nisi victor discesserit auxeritque imperium subacto Persarum rege nomine Abgaro. neque minus Arabas, simul ut adortus est, in dicionem redegit provinciae modo. 20,17: ob haec tanta Arabicum, Adiabenicum et Parthici cognomento patres dixere.
f) Hist. Aug. sept. Sev. 9,9 sq.: deinde circa Arabiam plura gessit, Parthis etiam in dicionem redactis nec non etiam Adiabenis, qui quidem omnes cum Pescennio senserant. atque ob hoc reversus triumpho delato appellatus est Arabicus Adiabenicus Parthicus. 18,1: Persarum regem Abgarum subegit. Arabas in dicionem accepit. Adiabenos in tributarios coegit.
g) Syncell. 435,16 sq.: Ϲεβῆροϲ Ἀδιαβηνοὺϲ καὶ Ἄραβαϲ ϲυμμαχήϲανταϲ τῷ Νίγερι καθυπέταξεν.
fr. 49
a) Eutr. 8,19,1: Severus tamen praeter bellicam gloriam etiam civilibus studiis clarus fuit et litteris doctus; philosophiae scientiam ad plenum adeptus.
d) Aur. Vict. 20,22: philosophiae, declamandi, cunctis postremo liberalium deditus studiis.
f) Hist. Aug. sept. Sev. 18,5: philosophiae ac dicendi studiis satis deditus, doctrinae quoque nimis cupidus.
fr. 50
d) Aur. Vict. 20,22: idemque ab se gesta ornatu et fide paribus composuit. 20,6: quem quamquam exacta aetate mortuum … statuentes illum {iustum} nasci aut emori minime convenisse.
f) Hist. Aug. sept. Sev. 18,6: vitam suam privatam publicamque ipse composuit ad fidem. 18,7: de hoc senatus ita iudicavit illum aut nasci non debuisse aut mori, quod et nimis crudelis et nimis utilis rei publicae videretur.
fr. 51
d) Aur. Vict. 20,23: huic tanto domi forisque uxoris probra summam gloriae dempsere, quam adeo famose complexus est, uti cognita libidine ac ream coniurationis retentaverit.
f) Hist. Aug. sept. Sev. 18,8: domi tamen minus cautus, qui uxorem Iuliam famosam adulteriis tenuit, ream etiam coniurationis.
fr. 52
d) Aur. Vict. 20,25 sq.: nam cum pedibus aeger bellum moraretur idque milites anxie ferrent eiusque filium Bassianum, qui Caesar una aderat, Augustum fecissent, in tribunal se ferri, adesse omnes imperatoremque ac tribunos, centuriones et cohortes, quibus auctoribus acciderat, sisti reorum modo iussit. quo metu cum stratus humi victor tantorum exercitus veniam precaretur, „sentitisne“, inquit, pulsans manu ⟨caput⟩, „caput potius quam pedes imperare ?“
f) Hist. Aug. sept. Sev. 18,9–11: idem, cum pedibus aeger bellum moraretur idque milites anxie ferrent eiusque filium Bassianum, qui una erant, Augustum fecissent, tolli se atque in tribunal ferri iussit, adesse deinde omnes tribunos, centuriones, duces et cohortes, quibus auctoribus id acciderat, sisti deinde filium, qui Augusti nomen acceperat. cumque animadverti in omnes auctores facti praeter filium iuberet rogare-
turque omnibus ante tribunal prostratis, caput manu contingens ait: ‘tandem sentitis caput imperare, non pedes.’
fr. 53
a) Eutr. 8,18,4: Clodius Albinus … Caesarem se in Gallia fecit victusque apud Lugdunum interfectus. 8,19,1: novissimum bellum in Britannia habuit, utque receptas provincias omni securitate muniret, vallum per CXXXII passuum milia a mari ad mare duxit.
b) Hier. chron. 212i: Clodio Albino qui se in Gallia Caesarem fecerat, aput Lugdunum interfecto Severus in Britannos bellum transfert. ubi, ut receptas provincias ab incursione barbarica faceret securiores, vallum per CXXXII passum milia a mari ad mare duxit.
d) Aur. Vict. 20,8 sq.: (Pescennium Nigrum apud Cyzicenos), Clodium Albinum Lugduni victos coegit mori. (quorum prior Aegyptum dux obtinens bellum moverat spe dominationis), alter … in Gallia invaserat imperium. 20,18: his maiora aggressus Britanniam, quoad ea utilis erat, pulsis hostibus muro munivit per transversam insulam ducto utrimque ad finem Oceani.
e) Epit. Caes. 20,2 sq.: Albinus qui in Gallia se Caesarem fecerat, apud Lugdunum occiditur. … hic in Britannia vallum per triginta duo passuum milia a mari ad mare deduxit.
f) Hist. Aug. sept. Sev. 10,1: bellum civile Clodi Albini nuntiatum est, qui rebellavit in Gallia. Hist. Aug. Alb. 12,3: cum apud Lugdunum eundem interfecisset. Hist. Aug. sept. Sev. 18,2: Britanniam, quod maximum eius imperii decus est, muro per transversam insulam ducto utrimque ad finem Oceani munivit.
fr. 54
b) Hier. chron. 212a: Severo imperante thermae Severianae aput Antiochiam et Romae factae et Septizonium exstructum.
f) Hist. Aug. sept. Sev. 19,5: opera publica praecipua eius extant Septizonium et thermae Severianae.
fr. 55
a) Eutr. 8,19,2: decessit Eboraci admodum senex, imperii anno sexto decimo, mense tertio.
b) Hier. chron. 213a: Severus moritur Eburaci in Britannia.
d) Aur. Vict. 20,27: neque multo post Britanniae municipio, cui Eboraci nomen, annis regni duodeviginti morbo extinctus est.
f) Hist. Aug. sept. Sev. 19,1: perit Eboraci in Britannia … anno imperii XVIII., morbo gravissimo extinctus, iam senex.
g) Syncell. 435,21 sq.: Ϲευῆροϲ εἰϲ Βρεττανίαν ἐλθὼν νόϲῳ πολεμίᾳ τελευτᾷ ἤγουν ἐπιληψίᾳ.
fr. 56
a) Eutr. 8,19,3: divus appellatus est. nam filios duos successores reliquit, Bassianum et Getam, sed Bassiano Antonini nomen a senatu voluit inponi. itaque dictus est M. Aurelius Antoninus Bassianus patrique successit. nam Geta hostis publicus iudicatus confestim periit.
d) Aur. Vict. 20,30–32: funus, quod liberi Geta Bassianusque Romam detulerant, mire celebratum illatumque Marci sepulcro; ⟨quem⟩ adeo percoluerat, ut eius gratia Commodum inter Divos referri suaserit fratrem appellans Bassianoque Antonini vocabulum addiderit. … at posteri, quasi bellum inter se mandatis accepissent, confestim secessere. ita Geta, cui nomen paterno ab avo erat, cum eius modestiore ingenio frater angeretur, obsessus interiit.
f) Hist. Aug. sept. Sev. 19,2–4: reliquit filios duos, Antoninum Bassianum et Getam, cui et ipsi in honorem Marci Antonini nomen inposuit. inlatus sepulchro Marci Antonini, quem ex omnibus imperatoribus tantum coluit, ut et Commodum in divos referret et Antonini nomen omnibus deinceps quasi Augusti adscribendum putaret. ipse a senatu agentibus liberis, qui ei funus amplissimum exhibuerant, inter divos est relatus.
fr. 57
b) Hier. chron. 213d: Antoninus Caracalla cognominatus propter genus vestis, quod Romae erogaverat, et e contrario caracallae ex eius nomine Antoninianae dictae.
d) Aur. Vict. 21,1 sq.: Antoninus incognita munerum specie plebem Romanam adliciens, quod indumenta in talos demissa largiretur, Caracalla dictus, cum pari modo vestes Antoninianas nomine suo daret. Alamannos, gentem populosam mirifice ex equo pugnantem, prope Moenum amnem devicit.
e) Epit. Caes. 21,2: at cum e Galla vestem plurimam devexisset talaresque caracallas fecisset coegissetque plebem ad se salutandum indutam talibus introire, de nomine huiusce vestis Caracalla cognominatus est.
f) f) Hist. Aug. Carac. 9,7 sq.: ipse Caracalli nomen accepit a vestimento, quod populo dederat, demisso usque ad talos. quod ante non fuerat. unde hodieque Antoninianae dicuntur caracallae huiusmodi, in usu maxime Romanae plebis frequentatae. Sept. Sev. 21,11: vestimenta populo dederit, unde Caracallus est dictus. Carac. 10,6: nam Alamannorum gentem devicerat.
fr. 58
a) Eutr. 8,20,1: inpatientis libidinis, qui novercam suam Iuliam uxorem duxerit.
b) Hier. chron. 213f: Antoninus tam impatiens libidinis fuit, ut novercam suam Iuliam uxorem duxerit.
d) Aur. Vict. 21,3: namque Iuliam novercam, … forma captus, coniugem affectavit, cum illa factiosior aspectui adolescentis, praesentiae quasi ignara, semet dedisset intecto corpore asserentique, „vellem, si liceret, uti“, petulantius multo … respondisset: „libet? plane licet.“
f) f) Hist. Aug. Carac. 10,1–3: interest scire quemadmodum novercam suam Iuliam uxorem duxisse dicatur. quae cum esset pulcherrima et quasi per neglegentiam se maxima corporis parte nudasset dixissetque Antoninus ‘vellem, si liceret’, respondisse fertur: ‘si libet, licet. an nescis te
imperatorem esse et leges dare, non accipere?’ quo audito furor inconditus ad effectum criminis roboratus est.
fr. 59
a) Eutr. 8,20,1: opus Romae egregium fecit lavacri, quae thermae Antoninianae appellantur.
b) Hier. chron. 213e: Antoninus Romae thermas sui nominis aedificavit.
d) Aur. Vict. 21,4: Aegypti sacra per eum deportata Romam atque aucta urbs magno accessu viae novae et ad lavandum absoluta opera cultus pulchri.
f) f) Hist. Aug. Carac. 9,10: sacra Isidis Romam deportavit et templa ubique magnifica eidem deae fecit. 9,9: idem viam novam munivit, quae est sub eius thermis, Antoninianis scilicet. 9,4: opera Romae reliquit thermas nominis sui eximias.
fr. 60
d) Aur. Vict. 20,33 sq.: quae victoria Papiniani exitio foedior facta, ut sane putant memoriae curiosi, quippe quem ferunt illo temporis Bassiani scrinia curavisse monitumque, uti mos est, destinanda Romam quam celerrime componeret, dolore Getae dixisse haudquaquam pari facilitate velari parricidium, qua fieret, idcircoque morte affectum. sed haec improbe absurda sunt, cum constet satis praefecturam praetorio gessisse neque incondite illum virum tantam contumeliam imponere potuisse, cui amori ac magisterio erat.
f) f) Hist. Aug. Carac. 8,1: scio de Papiniani nece multos ita in litteras rettulisse, ut caedis non adsciverint causam, aliis alia referentibus; sed ego malui varietatem opinionum edere quam de tanti viri caede reticere. 8,5: multi dicunt Bassianum occiso fratre illi mandasse, ut et in senatu pro se et apud populum facinus dilueret, illum autem respondisse non tam facile parricidium excusari posse quam fieri.
fr. 61
a) Eutr. 8,20,2: defunctus est in Osdroena apud Edessam … anno imperii sexto, mense secundo, vix egressus quadragesimum tertium annum. funere publico elatus est.
b) Hier. chron. 213g: Antoninus (interficitur inter Edessam et Carras) anno aetatis XLIII.
c) Ruf. Fest. 21,3: Antoninus cognomento Caracalla, filius Severi imperatoris, expeditionem in Persas parans, in Osrhoena apud Edessam propria morte obiit et ibidem sepultus est.
d) Aur. Vict. 21,5 sq.: apud Edessam anno potentiae sexto moritur. corporis reliqua luctu publico relata Romam atque inter Antoninos funerata sunt.
f) f) Hist. Aug. Carac. 9,1: Bassianus vixit annis quadraginta tribus. imperavit annis sex. publico funere elatus est. 9,12: corpus eius Antoninorum sepulchro inlatum est.
fr. 62
a) Eutr. 8,21: deinde Opilius Macrinus, qui praefectus praetorio erat, cum filio Diadumeno facti imperatores nihil memorabile ex temporis brevitate gesserunt. nam imperium eorum duum mensium et unius anni fuit. seditione militari ambo pariter occisi sunt.
b) Hier. chron. 213h: Macrinus praefecturam praetorio gerens imperator factus.
d) Aur. Vict. 22,1–4: dehinc Opilius Macrinus, qui praefecturam praetorio gerebat, imperator eiusdemque filius Diadumenus nomine Caesar a legionibus appellantur. quibus eo quod ingens amissi principis desiderium erat, adolescentem Antoninum vocavere. horum nihil praeter saevos atque inciviles animos interim reperimus. qua gratia mensibus fere quattuor ac decem vix retento imperio, per quos creati fuerant, interfecti sunt.
f) Hist. Aug. Heliog. 2,3: Macrino, qui saevissime cum filio luxurioso et crudeli exercuit imperium. 3,1: excitatisque omnibus ordinibus, omni etiam populo ad nomen Antoninum, quod non solum titulo, ut in Diadumeno fuerat, sed etiam in sanguine redditum videbatur, cum se Antonini Bassiani filium scripsisset, ingens eius desiderium factum est.
g) Syncell. 436,15 sq.: Μακρῖνοϲ δὲ τούτου παῖϲ ϲυνὼν αὐτῷ διεδέξατο τὴν ἀρχήν, ἔτοϲ α´ ἄρξαϲ καὶ μῆναϲ ζ´, ὥϲ τινεϲ.
fr. 63
a) Eutr. 8,22: creatus est post hos M. Aurelius Antoninus. hic Antonini Caracallae filius putabatur; sacerdos autem Heliogabali templi erat. is cum Romam ingenti et militum et senatus expectatione venisset, probris se omnibus contaminavit. inpudicissime et obscenissime vixit biennioque post et octo mensibus tumultu interfectus est militari et cum eo mater Symiasera.
b) Hier. chron. 214e: M. Aurelius Antoninus, Antonini Caracallae, ut putabatur, filius et sacerdos Heliogabali templi, adeo impudice in imperio suo vixit, ut nullum genus obscenitatis omiserit. 214g: Heliogabalum templum Romae aedificatum. 214i: Antoninus Romae occiditur tumultu militari cum matre Symiasera.
d) Aur. Vict. 23,1–3: accitusque Marcus Antoninus Bassiano genitus, qui patre mortuo in Solis sacerdotium, quem Heliogabalum Syri vocant, tamquam asylum insidiarum metu confugerat, hincque Heliogabalus dictus. translatoque Romam dei simulacro in palatii penetralibus altaria constituit. hoc impurius ne improbae quidem aut petulantes mulieres fuere. … in castris praetoriis tricesimo regni mense oppressus est.
e) Epit. Caes. 23,1–3: Aurelius Antoninus Varius, idem Heliogabalus dictus, Caracallae ex Soemea consobrina occulte stuprata filius, imperavit biennio et mensibus octo. huius matris avus Bassianus nomine fuerat Solis sacerdos; quem Phoenices unde erat, Heliogabalum nominabant, a quo iste Heliogabalus dictus est. is cum Romam ingenti militum et senatus exspectatione venisset, probris se omnibus contaminavit. 23,5: ipse tumultu militari interfectus est.
f) Hist. Aug. Heliog. 1,5 sq.: fuit autem Heliogabali vel Iovis vel Solis sacerdos atque Antonini sibi nomen asciverat … dictus est … post Heliogabalus a sacerdotio dei Heliogabali, cui templum Romae … constituit. 18,2: occisa est cum eo et mater Symiamira.
fr. 64
a) Eutr. 8,23: successit huic Aurelius Alexander, ab exercitu Caesar, a senatu Augustus nominatus, iuvenis admodum; susceptoque adversus Persas bello Xerxen eorum regem gloriosissime vicit. militarem disciplinam severissime rexit. quasdam tumultuantes legiones integras exauctoravit. … periit in Gallia militari tumultu.
b) Hier. chron. 215a: Alexander Xerxem regem Persarum gloriosissime vicit et disciplinae militaris tam severus corrector fuit, ut quasdam tumultuantes legiones integras exauctoraverit. 216c: Alexander occiditur Mogontiaci tumultu militari.
c) Ruf. Fest. 22,1: Persarum regem nobilissimum Xersem gloriose vicit.
d) Aur. Vict. 23,3: Alexandri, quem comperta Opilii nece Caesarem nobilitas nuncupaverat. 24,1–4: statimque Aurelio Alexandro Syriae ⟨urbe⟩ orto, cui duplex Caesarea et Arcae nomen est, militibus quoque annitentibus Augusti potentia delata. qui quamquam adolescens, ingenio supra aevum tamen, confestim apparatu magno bellum adversum Xerxen, Persarum regem, movet. quo fuso fugatoque in Galliam maturrime contendit, quae Germanorum direptionibus tentabatur. ibi tumultuantes legionum plerasque constantissime abiecit, quod in praesens gloriae, mox exitio datum est. nam cum tantae severitatis vim milites inhorrescunt … agentem casu cum paucis vico Britanniae, cui vocabulum Sicilia, trucidavere.
f) Hist. Aug. Alex. 1,2: Aurelius Alexander, urbe Arcena genitus, … accepit imperium, cum ante Caesar a senatu esset appellatus, mortuo scilicet Macrino. 52,3: severitatis autem tantae fuit in milites ut saepe legiones integras exauctoraverit. 55,1 sq.: magno igitur apparatu inde in Persas profectus (Artaxerxem) regem potentissimum vicit … fuso fugatoque tanto rege. 59,2: erat autem gravissimum rei p. atque ipsi, quod Germanorum vastationibus Gallia diripiebatur. 59,4: sed cum ibi quo-
que seditiosas legiones conperisset, abici eas praecepit. 59,6: denique agentem eum cum paucis in Brittannia, ut alii volunt in Gallia, in vico cui Sicilia nomen est, non ex omnium sententia, sed latrocinantium modo quidam milites et hi praecipue, qui Heliogabali praemiis effloruerunt. 64,4: scio sane plerosque negare hunc a senatu Caesarem appellatum esse, sed a militibus.
g) Syncell. 437,22 sq.: ἀλλ’ εἰϲ Ῥώμην ἐπανελθὼν ἀναιρεῖται ϲὺν τῇ μητρὶ Μαμμαίᾳ ὑπὸ ϲτρατιωτικοῦ θορύβου. 439,7–9: καὶ Ἀλέξανδροϲ μετὰ … τὴν κατὰ Περϲῶν εὐδοκίμηϲιν ἐπανελθὼν ἐν Ῥώμῃ ἀναιρεῖται ϲὺν μητρὶ Μαμμαίᾳ ἐν Μογοντιακῷ ϲτρατιωτικῇ ἐπαναϲτάϲει.
fr. 65
a) Eutr. 8,23: adsessorem habuit vel scrinii magistrum Ulpianum iuris conditorem.
b) Hier. chron. 215c: Ulpianus iuris consultus assessor Alexandri insignissimus habetur.
c) Ruf. Fest. 22,1: hic Alexander scriniorum magistrum habuit Ulpianum iuris consultorem.
d) Aur. Vict. 24,6: adhuc Domitium Ulpianum, quem Heliogabalus praetorianis praefecerat, eodem honore retinens Pauloque inter exordia patriae reddito, iuris auctoribus, quantus erga optimos atque aequi studio esset, edocuit.
f) Hist. Aug. Alex. 26,5 sq.: Paulum et Ulpianum in magno honore habuit, quos praefectos ab Heliogabalo alii dicunt factos, alii ab ipso – nam et consiliarius Alexandri et magister scrinii Ulpianus fuisse perhibetur –, qui tamen ambo assessores Papiniani fuisse dicuntur.
fr. 66
a) Eutr. 8,23: Romae quoque favorabilis fuit. periit in Gallia militari tumultu tertio decimo imperii anno et die nono. in Mamaeam matrem su-
am unice pius. 7,15,2: aedificavit Romae thermas, quae ante Neronianae dictae nunc Alexandrinae appellantur.
b) Hier. chron. 215: Romanorum XXI regnavit Alexander, Mammaeae filius ann. XIII. 215c: Ulpianus iuris consultus assessor Alexandri insignissimus habetur. 215i: Alexander in matrem Mammaeam unice pius fuit et ob id omnibus amabilis. 183d: Thermae a Nerone aedificatae quas Neronianas appellavit.
d) Aur. Vict. 24,7: neque ultra annos tredecim imperio functus. 24,5: opus urbi florentissimum †celebrio† fabricatus est matrisque cultu, quae nomine Mammaea erat, plus quam pius.
f) Hist. Aug. Alex. 4,5: erat praeterea cunctis hominibus amabilis et ab aliis pius appellabatur. 25,3: opera veterum principum instauravit, ipse nova multa constituit, in his thermas nominis sui iuxta eas, quae Neronianae fuerunt, aqua inducta, quae Alexandriana nunc dicitur. 26,9: in matrem Mammaeam unice pius fuit.
fr. 67
a) Eutr. 9,1: post hunc Maximinus ex corpore militari primus ad imperium accessit sola militum voluntate, cum nulla senatus intercessisset auctoritas neque ipse senator esset.
b) Hier. chron. 216d: Maximinus primus ex corpore militari sine senatus auctoritate ab exercitu imperator electus est.
d) Aur. Vict. 25,1 sq.: Gaius Iulius Maximinus … primus e militaribus, litterarum fere rudis potentiam cepit suffragiis legionum. quod tamen etiam patres, dum periculosum aestimant inermes armato resistere, approbaverunt.
e) Epit. Caes. 25,1: Iulius Maximinus Thrax, ex militaribus
Hist. Aug. Maximin. 8,1: Maximinus primus e corpore militari et nondum senator, sine decreto senatus, Augustus ab exercitu appellatus est.
g) Syncell. 437,23–5: Μάξιμοϲ δέ τιϲ Μυϲὸϲ τὸ γένοϲ ϲτρατηγὸϲ Κελτικῆϲ ὑπὸ τῶν ϲτρατευμάτων βαϲιλεὺϲ Ῥωμαίων ἀνηγορεύθη.
fr. 68
a) Eutr. 9,1: is bello adversus Germanos feliciter gesto cum a militibus imperator esset appellatus, a Pupieno Aquileiae occisus est, deserentibus eum militibus suis, cum filio adhuc puero.
b) Hier. chron. 216g: Maximinus Aquileiae a Pupieno occiditur.
d) Aur. Vict. 26,1: haud incommode proelio gesto contra Germanos. 27,4: eos Pupienus Aquileiae obsidione confecit, postquam proelio victos reliqui paulatim deseruerant.
f) Hist. Aug. Max. Balb. 15,4: sed multi non a Maximo, verum a Puppieno imperatore victum apud Aquileiam Maximinum esse dixerunt. 16,7: sed apud Latinos scriptores plerosque Maximi nomen non invenio et cum Balbino Puppienum imperatorem repperio, … cum, memoratis historicis asserentibus, ne Maximus quidem contra Maximinum pugnasse doceatur, sed resedisse apud Ravennam atque illic patratam audisse victoriam. 18,2: siquidem per haec tempora apud Graecos non facile Puppienus, apud Latinos non facile Maximus inveniatur, et ea, quae gesta sunt contra Maximinum, modo a Puppieno, modo a Maximo acta dicantur. Maximin. 33,3: sane quod nullo in loco tacendum est: cum et Dexippus et Arrianus et multi alii Graeci scripserint Maximum et Balbinum imperatores contra Maximinum factos, Maximum autem cum exercitu missum et apud Ravennam bellum parasse, Aquileiam autem nisi victorem non vidisse, Latini scriptores non Maximum sed Puppienum contra Maximinum apud Aquileiam pugnasse dixerunt eundemque vicisse.
fr. 69
a) Eutr. 9,2,1: postea tres simul Augusti fuerunt, Pupienus, Balbinus, Gordianus, duo superiores obscurissimo genere, Gordianus nobilis, quippe cuius pater, senior Gordianus, consensu militum, cum proconsulatum Africae gereret, Maximino imperante princeps fuisset electus.
d) Aur. Vict. 26,1: repente Antonius Gordianus Africae proconsul ab exercitu princeps apud Thysdri oppidum absens fit. 26,7: at senatus … Clodium Pupienum, Caecilium Balbinum Caesares constituit. 27,1: iisdemque per Africam diebus milites Gordianum, Gordiani filium, qui forte contubernio patris praetextatus ac deinceps praefectus praetorio intererat, Augustum creavere.
f) Hist. Aug. Gord. 2,1: Gordiani non, ut quidam inperiti scriptores locuntur, duo sed tres fuerunt. Opil. 3,5: nec inter Antoninos referendi sunt duo Gordiani. Diad. 6,3: unde postea duos Gordianos, patrem et filium. Heliog. 34,6: etiam illud addendum est, ne quis error oriatur, cum duos Gordianos narrare coepero, patrem et filium.
g) Amm. 26,6,20: superior Gordianus. 23,5,17: iunior Gordianus.
fr. 70
a) Eutr. 9,2,2: itaque cum Romam venissent Balbinus et Pupienus, in palatio interfecti sunt, soli Gordiano imperium reservatum.
b) Hier. chron. 216i: Gordiano Romam ingresso Pupienus et Balbinus, qui imperium arripuerant, in Palatio occisi.
d) Aur. Vict. 27,6: neque multo post tumultu militarium Clodio Caelioque Romae intra palatium caesis Gordianus solus regnum obtinuit.
e) Epit. Caes. 26,2: pari etiam tenore Pupienus et Balbinus regnum invadentes perempti sunt.
fr. 71
a) Eutr. 9,2,2 sq.: Gordianus admodum puer … Ianum Geminum aperuit et ad Orientem profectus Parthis bellum intulit, qui iam moliebantur erumpere. quod quidem feliciter gessit proeliisque ingentibus Persas adflixit. rediens haud longe a Romanis finibus interfectus est fraude Philippi.
b) Hier. chron. 217a: Gordianus admodum adulescens Parthorum natione superata cum victor reverteretur ad patriam, fraude Filippi praefecti praetorio haut longe a Romano solo interfectus est.
c) Ruf. Fest. 22,2: sub Gordiano, acri ex iuventatis fiducia principe, rebellantes Parthi ingentibus proeliis contusi sunt. isque rediens victor de Perside fraude Philippi, qui praefectus praetorio eius erat, occisus est.
d) Aur. Vict. 27,7 sq.: in Persas profectus est, cum prius Iani aedes, quas Marcus clauserat, patentes more veterum fecisset. ibi gesto insigniter bello Marci Philippi praefecti praetorio insidiis periit sexennio imperii.
f) Hist. Aug. Gord. 26,3: Gordianus, aperto Iano gemino, quod signum erat indicti belli, profectus est contra Persas cum exercitu ingenti. 26,5: illic frequentibus proeliis pugnavit et vicit.
g) Amm. 23,5,17 (Rede Julians): redissetque pari splendore iunior Gordianus … apud Resainan superato fugatoque rege Persarum, ni factione Philippi praefecti praetorio sceleste iuvantibus paucis in hoc, ubi sepultus est, loco vulnere impio cecidisset.
Syncell. 443,4–9: οὗτοϲ ἐξ ’Ιταλίαϲ εἰϲ Πάρθουϲ ἐλθὼν καὶ Ϲαπώρην τὸν ’Αρταξέρξου υἱὸν Περϲῶν βαϲιλέα πολεμήϲαϲ ἐτρέψατο. … ἀλλὰ πρὸϲ Κτηϲιφῶντα γενόμενοϲ ἀναιρεῖται ὑπὸ τῶν οἰκείων ϲτρατιωτῶν ὑπάρχου Φιλίππου γνώμῃ τοῦ μετ’ αὐτὸν βαϲιλεύϲαντοϲ ἔτη ε´, κατὰ δὲ τοὺϲ πολλοὺϲ ἔτη ζ´.
fr. 72
a) Eutr. 9,2,3: miles ei tumulum vicesimo miliario a Circesio, quod castrum nunc Romanorum est Euphratae inminens, aedificavit, exequias Romam revexit.
b) Hier. chron. 217b: Gordiano milites tumulum aedificant, qui Eufratae imminet, ossibus eius Romam revectis.
c) Ruf. Fest. 22,2: milites ei tumulum in vicensimo miliario a Circensio, quod nunc exstat, aedificaverunt atque exequias eius Romam cum maxima venerationis reverentia deduxerunt.
e) Epit. Caes. 27,3: corpus eius prope fines Romani Persicique imperii positum nomen loco dedit Sepulcrum Gordiani.
f) Hist. Aug. Gord. 34,2: Gordiano sepulchrum milites apud Circesium castrum fecerunt in finibus Persidis.
g) Amm. 23,5,17: Gordianus, cuius monumentum nunc vidimus honorate.
fr. 73
a) Eutr. 9,3,1: Philippi duo, filius ac pater.
b) Hier. chron. 217c: Philippus Philippum filium suum consortem regni facit.
d) Aur. Vict. 28,1: Philippus … sumpto in consortium Philippo filio.
fr. 74
a) Eutr. 9,3: his imperantibus millesimus annus Romae urbis ingenti ludorum apparatu spectaculorumque celebratus est.
b) Hier. chron. 217d: regnantibus Philippis millesimus annus Romanae urbis expletus est. ob quam sollemnitatem innumerabiles bestiae in circo magno interfectae ludique in campo Martio theatrales tribus diebus ac noctibus populo pervigilante celebrati.
d) Aur. Vict. 28,1: annum urbis millesimum ludis omnium generum celebrant.
f) Hist. Aug. Gord. 33,2 sq.: has autem omnes feras (in 33,1 aufgezählte Tiere) mansuetas et praeterea efferatas parabat ad triumphum Persicum. quod votum publicum nihil valuit. nam omnia haec Philippus exhibuit saecularibus ludis et muneribus atque circensibus, cum millesimum annum a condita Urbe in consulatu suo et filii sui celebravit.
fr. 75
b) Hier. chron. 217g: Filippus urbem nominis sui in Thracia construxit.
d) Aur. Vict. 28,1: Marcus Iulius Philippus, Arabs Thraconites, … conditoque apud Arabiam Philippopoli oppido Romam venere.
fr. 76
a) Eutr. 9,3: ambo deinde ab exercitu interfecti sunt, senior Philippus Veronae, Romae iunior; annis quinque imperaverunt.
b) Hier. chron. 218b: Philippus senior Veronae, Romae iunior occiditur.
d) Aur. Vict. 28,10 sq.: his actis filio urbi relicto ipse quamquam debili per aetatem corpore adversum Decium profectus Veronae cadit pulso amissoque exercitu. quis Romae compertis apud castra praetoria filius interficitur.
e) Epit. Caes. 28,1–3: Marcus Iulius Philippus imperavit annos V. Veronae ab exercitu interfectus est (medio capite supra ordines dentium praeciso). filius autem eius (Gaius Iulius Saturninus), quem potentiae sociaverat, Romae occiditur.
fr. 77
a) Eutr. 9,4: post hos Decius e Pannonia inferiore, Budaliae natus, imperium sumpsit. … filium suum Caesarem fecit.
b) Hier. chron. 218c: Decius e Pannonia inferiore Budaliae natus fuit.
d) Aur. Vict. 29,1: at Decius, Sirmiensium vico ortus, militiae gradu ad imperium conspiraverat, laetiorque hostium nece filium Etruscum nomine Caesarem fecit.
e) Epit. Caes. 29,1: Decius e Pannonia inferiore, Bubaliae natus … hic Decium filium suum Caesarem fecit.
fr. 78
a) Eutr.9,4: Romae lavacrum aedificavit.
d) Aur. Vict. 29,1: Romae aliquantum moratur moenium gratia, quae instituit, dedicandorum.
fr. 79
a) Eutr. 9,4: cum biennio imperassent ipse et filius, uterque in barbarico interfecti sunt.
b) Hier. chron. 218h: Decius cum filio in Abryto occiditur.
d) Aur. Vict. 29,4: Decii barbaros trans Danubium persectantes Bruti fraude cecidere exacto regni biennio.
e) Epit. Caes. 29,3 sq.: in solo barbarico inter confusas turbas gurgite paludis submersus est, ita ut nec cadaver eius potuerit inveniri. filius vero eius bello extinctus est.
g) Syncell. 445,3: Ῥωμαίων κδ´ ἐβαϲίλευϲε Δέκιοϲ ἔτη β´.
fr. 80
a) Eutr. 9,5: mox imperatores creati sunt Gallus Hostilianus et Galli filius Volusianus. sub his Aemilianus in Moesia res novas molitus est; ad quem opprimendum cum ambo profecti essent, Interamnae interfecti sunt non conpleto biennio. … sola pestilentia et morbis atque aegritudinibus notus eorum principatus fuit.
b) Hier. chron. 219f: Gallus et Volusianus, cum adversum Aemilianum, qui in Moesia res novas moliebatur, ex urbe profecti essent, in foro Flamini sive, ut alii putant, Interamnae interfecti sunt.
d) Aur. Vict. 30,1–31,1: haec ubi patres comperere, Gallo Hostilianoque Augusta imperia, Volusianum Gallo editum Caesarem decernunt. deinde pestilentia oritur. qua atrocius saeviente Hostilianus interiit. … igitur his Romae morantibus Aemilius Aemilianus summam potestatum corruptis militibus arripuit. 31,2: ad quem expugnandum profecti Interamnae ab suis caeduntur. 31,3: his sane omnibus biennium profecit.
e) Epit. Caes. 30,1–31,1: Virius Gallus cum Volusiano filio imperaverunt annos II. horum temporibus Hostilianus Perpenna a senatu imperator creatus nec multo post pestilentia consumptus est. sub his etiam Aemilianus in Moesia imperator effectus est. contra quem ambo profecti apud Interamnam ab exercitu suo caeduntur.
fr. 81
a) Eutr. 9,6: Aemilianus obscurissime natus obscurius imperavit ac tertio mense extinctus est.
b) Hier. chron. 219g: Aemilianus tertio mense invasae tyrannidis extinctus.
d) Aur. Vict. 31,3: nam Aemilianus quoque tres menses usus modesto imperio morbo absumptus est.
fr. 82
a) Eutr. 9,7: hinc Licinius Valerianus in Raetia et Norico agens ab exercitu imperator et mox Augustus est factus. Gallienus quoque Romae a senatu Caesar est appellatus. horum imperium Romano nomini perniciosum et paene exitiabile fuit vel infelicitate principum vel ignavia: Germani Ravennam usque venerunt; Valerianus in Mesopotamia bellum gerens a Sapore Persarum rege superatus est, mox etiam captus apud Parthos ignobili servitute consenuit. 9,11,1: Gallienus … occisus est imperii anno nono.
b) Hier. chron. 220a: Valerianus in Raetia ab exercitu Augustus, Gallienus Romae a senatu Caesar appellatus. 220d: Valerianus … a Sapore Persarum rege capitur ibique servitute miserabili consenescit. 220i: Germani Ravennam usque venerunt.
c) Ruf. Fest. 23,1: Valeriani, infausti principis, fortunam taedet referre. is cum Gallieno suscepit imperium, cum Valerianum exercitus, Gallienum senatus imperatorem fecisset. in Mesopotamia adversum Persas Valerianus congressus a Sapore, Persarum rege, superatus est et captus in dedecori servitute consenuit.
d) Aur. Vict. 32,1: at milites, qui contracti undique apud Raetias ob instans bellum morabantur, Licinio Valeriano imperium deferunt. 32,3: eius filium Gallienum senatus Caesarem creat. 32,4–5: prudentes perniciosum rei publicae cecinere adolescentis fluxo ingenio … quod equidem confestim evenit. nam cum eius pater bellum per Mesopotamiam anceps diuturnumque instruit, Persarum regis, cui nomen Sapor erat, dolo circumventus foede laniatus interiit imperii anno sexto, senecta robustiore. 33,35: huic (sc. Gallieno) novem annorum potentia fuit.
f) Hist. Aug. Gall. 21,5: de annis autem Gallieni et Valeriani ad imperium pertinentibus adeo incerta traduntur, ut, cum quindecim annos eosdem imperasse constet, id est Gallienus usque ad quintum decimum pervenisset, Valerianus vero sexto sit captus, alii novem annis, vix decem alii etiam Gallienum imperasse in litteras mittant.
fr. 83
a) Eutr. 9,8,1 sq.: Gallienus cum adulescens factus esset Augustus, imperium primum feliciter, mox commode, ad ultimum perniciose gessit. nam iuvenis in Gallia et Illyrico multa strenue fecit occiso apud Mursam Ingenuo, qui purpuram sumpserat, et Trebelliano. diu placidus et quietus, mox in omnem lasciviam dissolutus tenendae rei publicae habenas probrosa ignavia et desperatione laxavit. Alamanni vastatis Galliis in Italiam penetraverunt. Dacia, quae a Traiano ultra Danubium fuerat adiecta, tum amissa est. Graecia, Macedonia, Pontus, Asia vastata est per Gothos, Pannonia a Sarmatis Quadisque populata est, Germani usque ad Hispanias penetraverunt et civitatem nobilem Tarraconem expugnaverunt, Parthi Mesopotamia occupata Syriam sibi coeperant vindicare
b) Hier. chron. 220i: Gallieno in omnem lasciviam dissoluto Germani Ravennam usque venerunt. 220k: Alamanni vastatis Galliis in Italiam transiere. 220l: Graecia, Macedonia, Pontus, Asia depopulata per Gothos, Quadi et Sarmatae Pannonias occupaverunt. 221a: Germanis Hispanias obtinentibus Tarracon expugnata est. Parthi Mesopotamiam tenentes Syriam incursaverunt.
c) Ruf. Fest. 23,2: sub Gallieno Mesopotamia invasa etiam Syriam sibi Persae coeperant vindicare. 8,2: sed sub Gallieno imperatore amissa est (sc. Dacia).
d) Aur. Vict. 33,1–3: sub idem tempus Licinius Gallienus cum a Gallia Germanos strenue arceret, in Illyricum properans descendit. ibi Ingenuum, quem curantem Pannonios comperta Valeriani clade imperandi cupido incesserat, Mursiae devicit moxque Regalianum, qui receptis militibus, quos Mursina labes reliquos fecerat, bellum duplicaverat. his prospere ac supra vota cedentibus more hominum secundis solutior rem Romanam quasi naufragio dedit cum Salonino filio, cui honorem Caesaris contulerat, adeo uti Thraciam Gothi libere pergressi Macedonas Achaeosque et Asiae finitima occuparent, Mesopotamiam Parthi, Orienti latrones seu mulier dominaretur, Alamannorum vis tunc aeque Italiam, Francorum gentes direpta Gallia Hispaniam possiderent vastato ac paene direpto Tarraconensium oppido nactisque in tempore navigiis pars in usque Africam permearet. et amissa trans Istrum, quae Traianus quaesiverat.
fr. 84
d) Aur. Vict. 33,6: inter haec ipse popinas ganeasque obiens lenonum ac vinariorum amicitiis haerebat, expositus Saloninae coniugi atque amori flagitioso filiae Attali, Germanorum regis, Pipae nomine.
e) Epit. Caes. 33,1: Gallienus … amori diverso paelicum deditus, Saloninae coniugis et concubinae, quam per pactionem, concessa parte superioris Pannoniae, a patre Marcomannorum rege matrimonii specie susceperat Pipam nomine.
f) Hist. Aug. Gall. 21,3: a matre sua Salonina appellatum esse ⟨***⟩ quamvis perdite dilexit, Piparam nomine, barbaram regis filiam ⟨***⟩. 21,6: nam et semper noctibus popinas dicitur frequentasse et cum lenonibus, mimis scurrisque vixisse. trig. tyr. 3,4: cum Gallienus luxuriae et popinis vacaret et amore barbarae mulieris consenesceret.
fr. 85
a) Eutr. 9,10: in Oriente per Odenathum Persae victi sunt defensa Syria, recepta Mesopotamia. usque ad Ctesiphontem Odenathus penetravit.
b) Hier. chron. 221d: Odenatus decurio Palmyrenus collecta agrestium manu ita Persas cecidit, ut ad Ctesifontem castra poneret.
c) Ruf. Fest. 23,2: Syriam sibi Persae coeperant vindicare, nisi quod turpe dictum est, Odenathus, decurio Palmyrenus, collecta Syrorum agrestium manu acriter restitisset et fusis aliquotiens Persis non modo nostrum limitem defendisset, sed etiam ad Ctesiphontem Romani ultor imperii, quod mirum dictu est, penetrasset.
f) f) Hist. Aug. Gall. 10,3: Nisibin et Carras statim occupat. 10,6: Odenatus autem ad Ctesifontem Parthorum multitudinem obsedit vastatisque circum omnibus locis innumeros homines interemit. trig. tyr. 15,3 sq. (Odenatus): Nisibin primum et Orientis pleraque cum omni Mesopotamia in potestatem recepit, deinde ipsum regem victum fugere coegit. postremo Ctesifonta usque Saporem et eius liberos persecutus captis concubinis.
fr. 86
a) Eutr. 9,9 sq.: tum desperatis rebus et deleto paene imperio Romano Postumus in Gallia obscurissime natus purpuram sumpsit et per annos decem ita imperavit, ut consumptas paene provincias ingenti virtute et moderatione reparaverit. qui seditione militum interfectus est, quod Mogontiacum, quae adversus eum rebellaverat Laeliano res novas moliente, diripiendam militibus tradere noluisset. post eum Marius vilissimus opifex purpuram accepit et secundo die interfectus est. Victorinus postea Galliarum accepit imperium, vir strenuissimus, sed cum nimiae libidinis esset et matrimonia aliena corrumperet, Agrippinae occisus est actuario quodam dolum machinante imperii sui anno secundo. huic successit Tetricus senator, qui Aquitaniam honore praesidis administrans absens a militibus imperator electus est et apud Burdigalam purpuram sumpsit. seditiones multas militum pertulit.
b) Hier. chron. 221g: Galliae per Postumum et Victorinum et Tetricum receptae.
d) Aur. Vict. 33,8–14: namque primus omnium Postumus, qui forte barbaris per Galliam praesidebat, imperium ereptum ierat. explosaque Germanorum multitudine Laeliani bello excipitur. quo non minus feliciter fuso suorum tumultu periit, quod flagitantibus Mogontiacorum direptiones, quia Laelianum iuverant, abnuisset. igitur eo occiso Marius, ferri
quondam opifex neque etiam tum militiae satis clarus, regnum capit. proinde cuncta ad extremum reciderant, uti talibus imperia ac virtutum omnium decus ludibrio essent. hinc denique ioculariter dictum nequaquam mirum videri, si rem Romanam Marius reficere contenderet, quam Marius eiusdem artis auctor stirpisque ac nominis solidavisset. hoc iugulato post biduum Victorinus deligitur, belli scientia Postumo par, verum libidine praecipiti. qua cohibita in exordio post biennii imperium constupratis vi plerisque, ubi Atticiani coniugem concupivit facinusque ab ea viro patefactum est, accensis furtim militibus per seditionem Agrippinae occiditur. … interim Victoria amisso Victorino filio, legionibus grandi pecunia comprobantibus Tetricum imperatorem facit, qui familia nobili praesidatu Aquitanos tuebatur, filioque eius Tetrico Caesarea insignia impartiuntur.
f) Hist. Aug. Gall. 4,5: nam per annos septem Postumus imperavit et Gallias ab omnibus circumfluentibus barbaris validissime vindicavit. trig. tyr. 3,4: ab omni exercitu et ab omnibus Gallis Postumus gratanter acceptus talem se praebuit per annos septem ut Gallias instauraverit. 6,3: tunc interfecto etiam Lolliano, solus Victorinus in imperio remansit; qui et ipse, quod matrimoniis militum et militarium corrumpendis operam daret, a quodam actuario, cuius uxorem stupraverat, composita factione, Agrippinae percussus, Victorino filio Caesare a matre Vitruvia sive Victoria … appellato, qui et ipse puerulus statim est interemptus, cum apud Agrippinam pater eius esset occisus. 8,1: Marius ex fabro, ut dicitur, ferrario triduo tantum imperavit. 24,1: interfecto Victorino et eius filio, mater eius Victoria – sive Vitruvia – Tetricum, senatorem populi Romani, praesidatum in Gallia regentem, ad imperium hortata … filiumque eius Caesarem nuncupavit.
fr. 87
a) Eutr. 9,11,2: hic Gothos Illyricum Macedoniamque vastantes ingenti proelio vicit. parcus vir ac modestus et iusti tenax ac rei publicae gerendae idoneus. … senatus eum ingenti honore decoravit, scilicet ut in curia clipeus ipsi aureus, item in Capitolio statua aurea poneretur.
b) Hier. chron. 221k: Claudius Gothos Illyricum et Macedoniam vastantes superavit. ob quae in curia clipeus ei aureus et in Capitolio statua aurea conlocata est.
d) Aur. Vict. 34,1: viri laborum patientis aequique ac prorsus dediti rei publicae.
e) Epit. Caes. 34,4: ea res sicut erat cunctis grata, non divi vocabulum modo, sed ex auro statuam prope ipsum Iovis simulacrum atque in curia imaginem auream proceres sacravere.
f) Hist. Aug. Claud. 3,2–4: ut senatus populusque Romanus novis eum honoribus post mortem adfecerit. illi clypeus aureus vel, ut grammatici locuuntur, clypeum aureum senatus totius iudicio in Romana curia conlocatum est … illi, quod nulli antea, populus Romanus sumpto suo in Capitolio ante Iovis Optimi Maximi templum statuam auream decem pedum conlocavit.
fr. 88
a) Eutr. 9,22,1: Constantius per filiam nepos Claudii traditur.
b) Hier. chron. 225g: Constantius Claudii ex filia nepos fuit.
d) Aur. Vict. 34,7: hoc siquidem Constantius et Constantinus atque imperatores nostri ⟨***⟩.
f) Hist. Aug. Claud. 13,2 sq.: Claudius, Quintillus et Crispus fratres fuerunt. Crispi filia Claudia; ex ea et Eutropio, nobilissimo gentis Dardanae viro, Constantius Caesar est genitus.
fr. 89
a) Eutr. 9,12: Quintillus post eum, Claudii frater, consensu militum imperator electus est, unicae moderationis vir et civilitatis, aequandus fratri vel praeferendus. consensu senatus appellatus Augustus septimo decimo imperii die occisus est.
b) Hier. chron. 222b: Quintilius, Claudii frater, a senatu Augustus appellatus. XVII imperii die Aquileiae occiditur.
e) Epit. Caes. 34,5: huic successit frater eius Quintillus. is paucis diebus imperium tenens interemptus est.
f) Hist. Aug. Claud. 12,3: frater eiusdem, vir sanctus et sui fratris, ut vere dixerim, frater, delatum sibi omnium iudicio suscepit imperium, non hereditarium sed merito virtutum, qui factus esset imperator, etiamsi frater Claudii principis non fuisset. 12,5: septima decima die … interemptus est.
fr. 90
a) Eutr. 9,13: post eum Aurelianus suscepit imperium, Dacia Ripensi oriundus … Romanam dicionem ad fines pristinos varia bellorum felicitate revocavit. superavit in Gallia Tetricum apud Catalaunos ipso Tetrico prodente exercitum suum, cuius adsiduas seditiones ferre non poterat; quin etiam per litteras occultas Aurelianum ita fuerat deprecatus, ut inter alia versu Vergiliano uteretur: „eripe me his, invicte, malis“. Zenobiam quoque, quae occiso Odenatho marito Orientem tenebat, haud longe ab Antiochia sine gravi proelio cepit ingressusque Romam nobilem triumphum quasi receptor Orientis Occidentisque egit praecedentibus currum Tetrico et Zenobia. qui quidem Tetricus corrector Lucaniae postea fuit ac privatus diutissime vixit; Zenobia autem posteros, qui adhuc manent, Romae reliquit.
b) Hier. chron. 222d: Aurelianus Tetrico aput Catalaunos prodente exercitum suum Gallias recepit. 222e: Zenobia aput Immas haut longe ab Antiochia vincitur, quae occiso Odenato marito Orientis tenebat imperium. 222g: Aurelianum Romae triumphantem Tetricus et Zenobia praecesserunt. e quibus Tetricus corrector postea Lucaniae fuit et Zenobia in urbe summo honore consenuit. a qua hodieque Romae Zenobiae familia nuncupatur.
c) Ruf. Fest. 24,1: Zenobia, Odenathi uxor … post mortem mariti feminea dicione Orientis tenebat imperium; quam Aurelianus … apud Immas haud procul ab Antiochia vicit et captam Romae triumphans ante currum duxit.
d) Aur. Vict. 35,3–5: simul Germanis Gallia demotis Tetrici … caesae legiones proditore ipso duce. namque Tetricus, cum Faustini praesidis dolo corruptis militibus plerumque peteretur, Aureliani per litteras praesidium imploraverat eique adventanti producta ad speciem acie inter pugnam se dedit. ita, uti rectore nullo solet, turbati ordines oppressi
sunt, ipse post celsum biennii imperium in triumphum ductus Lucaniae correcturam filioque veniam atque honorem senatorum cooptavit.
f) Hist. Aug. Aurelian. 22,1: Zenobiam, quae … orientale tenebat imperium; 32,3 sq.: (Aurelianus) Occidentem petit atque, ipso Tetrico exercitum suum prodente quod eius scelera ferre non posset, deditas sibi legiones obtinuit. princeps igitur totius orbis Aurelianus, pacatis Oriente, Gallis atque undique terris, Romam iter flexit, ut de Zenobia et Tetrico, hoc est de Oriente et de Occidente, triumphum Romanis oculis exhiberet. 39,1: Tetricum triumphatum correctorem Lucaniae fecit, filio eius in senatu manente. trig. tyr. 24,2–5: et cum multa Tetricus feliciterque gessisset et diuque imperasset, ab Aureliano victus, cum militum suorum impudentiam et procacitatem ferre non posset, volens se gravissimo principi et severissimo dedit. versus denique illius fertur quem statim ad Aurelianum scripserat: „eripe me his, invicte, malis.“ quare … senatorem popui Romani eundemque consularem, qui iure praesidiali omnes Gallias rexerat, per triumphum duxit, eodem tempore quo et Zenobiam. … pudore tamen victus, vir nimium severus eum quem triumphaverat, correctorem totius Italiae fecit, id est Campaniae, Samni, Lucaniae Brittiorum, Apuliae Calabriae, Etruriae atque Umbriae, Piceni et Flaminiae omnisque annonariae regionis, ac Tetricum non solum vivere, sed etiam in summa dignitate manere passus est, cum illum saepe collegam, nonnumquam commilitonem, aliquando etiam imperatorem appellaret. 25,2: qui (der jüngere Tetricus) et ipse cum patre per triumphum ductus, postea omnibus senatoriis honoribus functus est.
g) Syncell. 467,13 sq.: Ζηνοβίᾳ δὲ τῇ γαμετῇ αὐτοῦ τὴν ἀρχὴν τῆϲ ἑῷαϲ ἐγχειρίζουϲι. 470,3–7: ταύτην τὴν ἀκοὴν Αὐρηλιανὸϲ οὐκ ἐνεγκὼν ἔρχεται μετὰ ϲτρατιᾶϲ καὶ πληϲίον Ἀντιοχείαϲ τῆϲ κατὰ Ϲυρίαν ἐν Ἴμμαιϲ καλουμένῳ χωρίῳ τοὺϲ μὲν Παλμυρηνοὺϲ διαφθείρει, Ζηνοβίαν δὲ χειρωϲάμενοϲ εἰϲ Ῥώμην ἤγαγε, καὶ φιλανθρωπίᾳ χρηϲάμενοϲ πολλῆ ϲυνάπτει ταύτην ἐνδόξωϲ ὰνδρὶ τῶν ὲν γερουϲίᾳ. 470,8: κρατεῖ δὲ καὶ Γάλλων κινηθέντων τότε.
g) Pol. Silv. princ. 49: sub quo … duo Tetrici pater et filius, qui se eidem dederunt et post purpuram iudices provinciarum facti sunt, sive Faustinus Treveris tyranni fuerunt.
fr. 91
a) Eutr. 9,13: vir in bello potens, animi tamen inmodici et ad crudelitatem propensioris. 9,14: hoc imperante etiam in urbe monetarii rebellaverunt vitiatis pecuniis et Felicissimo rationali interfecto. quos Aurelianus victos ultima crudelitate conpescuit. plurimos nobiles capite damnavit. saevus et sanguinarius ac necessarius magis in quibusdam quam in ullo amabilis imperator. trux omni tempore, etiam filii sororis interfector, disciplinae tamen militaris et morum dissolutorum magna ex parte corrector. 9,15: urbem Romam muris firmioribus cinxit. templum Soli aedificavit, in quo infinitum auri gemmarumque constituit.
b) Hier. chron. 223a: Aurelianus templum Soli aedificat et Romam firmoiribus muris vallat. 223b: primus agon Solis ab Aureliano institutus.
d) Aur. Vict. 35,6 sq.: neque secus intra urbem monetae opifices deleti, qui, cum auctore Felicissimo rationali nummariam notam corrosissent, poenae metu bellum fecerant usque eo grave, uti per Caelium montem congressi septem fere bellatorum milia confecerint. his tot tantisque prospere gestis fanum Soli magnificum Romae constituit donariis ornans opulentis, ac ne unquam, quae per Gallienum evenerant, acciderent, muris urbem quam validissimis laxiore ambitu circumsaepsit.
e) Epit. Caes. 35,4: hoc tempore in urbe Roma monetarii rebellarunt, quos Aurelianus victos ultima crudelitate compescuit. 35,6: hic muris validioribus et laxioribus urbem saepsit. 35,9: fuit saevus et sanguinarius et trux omni tempore, etiam filii sororis interfector.
f) Hist. Aug. Aurelian. 21,5 sq.: Aurelianus, ut erat natura ferocior, plenus irarum Romam petiit vindictae cupidus quam seditionum asperitas suggerebat; incivilius denique usus imperio, vir alias optimus, seditionum auctoribus interemptis, cruentius ea quae mollius fuerant curanda compescuit. interfecti sunt enim nonnulli etiam nobiles senatores. 21,9: his actis, cum videret posse fieri ut aliquid tale iterum quale sub Gallieno evenerat proveniret, adhibito consilio senatus muros urbis Romae
dilatavit. 31,4: crudelitas denique Aureliani vel, ut quidam dicunt severitas. 38,2: fuit sub Aureliano etiam monetariorum bellum, Felicissimo rationali auctore; quod acerrime severissimeque compescuit, septem tamen milibus suorum militum interemptis. 39,2: templum Solis magnificentissimum constituit. muros urbis Romae sic ampliavit ut quinquaginta prope milia murorum eius ambitus teneat. 39,6: in templo Solis multum auri gemmarumque constituit. 39,8 sq.: dicitur praeterea huius fuisse crudelitatis ut plerisque senatoribus simulatam ingereret factionem coniurationis et tyrannidis quo facilius eos posset occidere. addunt nonnulli filium sororis, non filiam ab eodem interfectum, plerique autem etiam filium sororis.
g) Syncell. 470,12 sq.: ὁ δ’ αὐτὸϲ καὶ Ἡλίου ναὸν ἐν Ῥώμῃ κατεϲκεύαϲε χρυϲῷ και λίθοιϲ ἀξιάγαϲτον.
fr. 92
d) Aur. Vict. 35,7: deletaeque fiscales et quadruplatorum, quae urbem miserabiliter affecerant, calumniae consumptis igni tabulis monumentisque huiuscemodi negotiorum atque ad Graeciae morem decreta abolitione; inter quae avaritiam, peculatum provinciarumque praedatores contra morem militarium, quorum e numero erat, immane quantum sectabatur.
f) Hist. Aug. Aurelian. 39,3–5: idem quadruplatores ac delatores ingenti severitate persecutus est. tabulas publicas ad privatorum securitatem exuri in foro Traiani semel iussit. amnestia etiam sub eo delictorum publicorum decreta est exemplo Atheniensium … fures provinciales repetundarum ac peculatus reos ultra militarem modum est persecutus, ut eos ingentibus suppliciis cruciatibusque puniret.
fr. 93
a) Eutr. 9,15,1: provinciam Daciam, quam Traianus ultra Danubium fecerat, intermisit vastato omni Illyrico et Moesia desperans eam posse retinere abductosque Romanos ex urbibus et agris Daciae in media Moesia conlocavit appellavitque eam Daciam, quae nunc duas Moesias dividit.
c) Ruf. Fest. 8,2: et per Aurelianum translatis exinde Romanis duae Daciae in regionibus Moesiae ac Dardania factae sunt.
f) Hist. Aug. Aurelian. 39,7: cum vastatum Illyricum ac Moesiam deperditam videret, provinciam Transdanuvianam Daciam a Traiano constitutam, sublato exercitu et provincialibus, reliquit, desperans eam posse retineri, abductosque ex ea populos in Moesia collocavit appellavitque suam Daciam, quae nunc duas Moesias dividit.
g) Syncell. 470,14 sq.: τὴν Τραϊανοῦ δὲ Δακίαν βαρβάροιϲ ἀφεὶϲ ἄνδραϲ καὶ γυναῖκαϲ εἰϲ τὸ μεϲαίτατον τῆϲ Μυϲίαϲ ϲτήϲαϲ ἑκατέρωθεν Δακίαν δὲ μέϲην ὀνομάζεϲθαι.
Suda δ 23: Δακία χώρα· ἣν ὁ Τραϊανὸϲ ἐν τοῖϲ πέραν τοῦ Ἴϲτρου χωρίοιϲ κατῴκιϲε. καὶ ταύτην Αὐρηλιανὸϲ ἀπέλιπε, κεκακωμένηϲ τῆϲ Ἰλλυριῶν τε καὶ Μυϲῶν χώραϲ, ἡγούμενοϲ ἀδυνάτωϲ ἔϲεϲθαι τὴν πέραν ἐν μέϲοιϲ τοῖϲ ποταμοῖϲ ἀπειλημμένην διαϲῴζεϲθαι. ἐξαγαγὼν οὖν τοὺϲ ἐκεῖϲε Ῥωμαίουϲ ἀπῳκιϲμένουϲ ἔκ τε τῶν πόλεων καὶ τῶν ἀγρῶν ἐν μέϲῃ τῇ Μυϲίᾳ καθίδρυϲε, τὴν χώραν ὀνομάϲαϲ Δακίαν ἣ νῦν ἐν μέϲῳ τῶν δύο Μυϲιῶν κειμένη διαιρεῖ αὐτὰϲ ἀπ’ ἀλλήλων.
fr. 94
a) Eutr. 9,15,2: occiditur servi sui fraude, qui ad quosdam militares viros, amicos ipsius, nomina pertulit adnotata falso manum eius imitatus, tamquam Aurelianus ipsos pararet occidere; itaque ut praeveniretur, ab isdem interfectus est in itineris medio, quod inter Constantinopolim et Heracleam est, stratae veteris; locus Caenophrurium appellatur. mors tamen eius inulta non fuit.
b) Hier. chron. 223c: ac non multo post inter Constantinopolim et Heracliam in Caenofrurio viae veteris occiditur.
d) Aur. Vict. 35,8: qua causa ministri scelere, cui secretorum officium crediderat, circumventus apud Caenofrurium interiit, cum ille praedae conscientia delictique scripta callide composita tribunis quasi per gratiam prodidisset, quibus interfici iubebantur. illique eo metu accensi facinus patravere.
f) Hist. Aug. Aurelian. 35,5: apud Caenofrurium mansionem, quae est inter Heracliam et Byzantium, malitia notarii sui … interemptus est.
g) Syncell. 470,9–11: ὁρμήϲαϲ δὲ καὶ ἐπὶ Ϲκύθαϲ ὑπὸ τῆϲ ἰδίαϲ ϲτρατιᾶϲ ἀναιρεῖται ϲτάϲει περιπεϲὼν μεταξὺ Βυζαντίου καὶ Ἡρακλείαϲ ἐν τῷ καινῷ λεγομένῳ φρουρίῳ τῶν Θρᾳκῶν.
fr. 95
a) Eutr. 9,14–15,2: necessarius magis in quibusdam quam in ullo amabilis imperator … meruit quoque inter Divos referri.
f) Hist. Aug. Aurelian. 37,1–4: hic finis Aureliano fuit, principi necessario magis quam bono. … rebus magnis gestis inter divos relatus est.
fr. 96
a) Eutr. 9,16: Tacitus post hunc suscepit imperium, vir egregie moratus et rei publicae gerendae idoneus. nihil tamen clarum potuit ostendere intra sextum mensem imperii morte praeventus. Florianus, qui Tacito successerat, duobus mensibus et diebus XX in imperio fuit neque quicquam dignum memoria egit.
b) Hier. chron. 223d: Romanorum XXX regnavit Tacitus mens. VI. 223e: quo aput Pontum occiso obtinuit Florianus imperium diebus LXXXVIII. hoc quoque aput Tarsum interfecto.
d) Aur. Vict. 35,12: atque etiam soli (d. h. Aurelian) interregni species obvenit. 36,1: igitur tandem senatus mense circiter post Aureliani interitum sexto Tacitum, e consularibus mitem sane virum, imperatorem creat, cunctis fere laetioribus, quod militari ferocia legendi ius principis proceres recepissent. 36,2: namque Tacito confestim a ducentesima regni luce Tyanae mortuo, cum tamen prius auctores Aureliani necis maximeque Mucaporem ducem, quod ipsius ictu occiderat, excruciavisset, Florianus, eiusdem frater, nullo senatus seu militum consulto imperium invaserat. 37,1: qui uno mense aut altero vix retentata dominatione apud Tarsum ab suis interficitur.
e) Epit. Caes. 35,10: hoc tempore septem mensibus interregni species evenit. 36,1–2: Tacitus post hunc suscepit imperium, vir egregie moratus; qui ducentesimo imperii die apud Tarsum febri moritur. huic successit Florianus.
f) Hist. Aug. Tac. 13,1: et prima quidem illi cura imperatoris facti haec fuit ut omnes qui Aurelianum occiderant interimeret. 13,4–5: gessit autem propter brevitatem temporum nihil magnum. interemptus est enim insidiis militaribus, ut alii dicunt, sexto mense, ut alii, morbo interiit. Tac. 13,6: huic frater Florianus in imperio successit. 14,1 sq.: hic frater Taciti germanus fuit, qui post fratrem arripuit imperium, non senatus auctoritate, sed suo motu … denique vix duobus mensibus imperium tenuit et occisus est Tarsi a militibus.14,5: duo igitur principes una extiterunt domo, quorum alter sex mensibus, alter vix duobus imperaverunt, quasi quidem interreges inter Aurelianum et Probum.
g) Pol. Silv. princ. 50 sq.: Tacitus. Florianus frater eius occisus.
fr. 97
a) Eutr. 9,17: Probus, vir inlustris gloria militari, ad administrationem rei publicae accessit. Gallias a barbaris occupatas ingenti proeliorum felicitate restituit. quosdam imperium usurpare conatos, scilicet Saturninum in Oriente, Proculum et Bonosum Agrippinae, certaminibus oppressit. vineas Gallos et Pannonios habere permisit, opere militari Almam montem apud Sirmium et Aureum apud Moesiam superiorem vineis conseruit et provincialibus colendos dedit. hic cum bella innumera gessisset, pace parata dixit brevi milites necessarios non futuros. … interfectus tamen est Sirmi tumultu militari in turri ferrata.
b) Hier. chron. 223g: Probus Gallias a barbaris occupatas ingenti virtute restituit. 224a: Probus Gallos et Pannonios vineas habere permisit Almamque et aureum montem militari manu consitos provincialibus colendos dedit. 224e: Probus tumultu militari aput Sirmium in turre, quae vocatur ferrata, occiditur.
d) Aur. Vict. 37,2: postquam Probum in Illyrico factum accepere, ingenti bello scientia exercitandisque varie militibus ac duranda iuventute prope Hannibalem alterum. 37,3: Galliam Pannoniasque et Moesorum col-
les vinetis replevit … simul caesis Saturnino per Orientem, Agrippinae Bonoso ⟨***⟩ exercitu. nam utrique dominatum tentaverant sumpta, cui duces praeerant, manu. qua causa receptis omnibus pacatisque dixisse proditur brevi milites frustra fore. 37,4: hinc denique magis irritati paulo cis sextum annum apud Sirmium trucidavere, cum ad siccandam lacunis ac fossa urbem ipsi patriam adigerentur, quae palustri solo hiemalibus aquis corrumpitur.
f) Hist. Aug. Prob. 3,1: Probus oriundus e Pannonia, civitate Sirmiensi, nobiliore matre quam patre … adfinitate non magna, tam privatus quam imperator nobilissimus virtutibus claruit. 18,4: sed habuit etiam non leves tyrannicos motus. nam et Saturninum, qui Orientis imperium adripuerat, variis proeliorum generibus et nota virtute superavit. 18,5: deinde, cum Proculus et Bonosus apud Agrippinam in Gallia imperium adripuissent omnesque sibi iam Brittannias, Hispanias et bracatae Galliae provincias vindicarent, barbaris semet iuvantibus vicit. 18,8: Gallis omnibus et Hispanis ac Brittannis hinc permisit, ut vites haberent vinumque conficerent. ipse Almam montem in Illyrico circa Sirmium militari manu fossum lecta vite conseruit. 20,1–3: a militibus suis per insidias interemptus est. … his addidit dictum eius grave, si umquam eveniat, salutare rei publica, brevi milites necessarios non futuros. 21,2 sq.: nam cum Sirmium venisset ac solum patrium effecundari cuperet et dilatari, ad siccandam quandam paludem multa simul milia militum posuit ingentem parans fossam qua, deiectis in Savum naribus loca Sirmiensibus profutura siccaret. hoc permoti milites, confugientem eum in turrem ferratam … interemerunt.
g) Pol. Silv. princ. 52 sq.: Probus, qui Gallis vineas habere permisit. sub quo Saturninus, Proculus et Bonosus tyranni fuerunt.
fr. 98
a) Eutr. 9,18,1 sq.: Carus est factus Augustus, Narbone natus in Gallia. is confestim Carinum et Numerianum filios Caesares fecit. … Numerianus … quem secum Caesarem ad Persas duxerat. 9,19,1: Carinus, quem Caesarem ad Parthos proficiscens Carus in Illyrico, Gallia, Italia reliquerat, omnibus se sceleribus inquinavit.
b) Hier. chron. 224g: Carus Narbonensis.
d) Aur. Vict. 38,1: igitur Carus praefectura pollens praetorii Augusto habitu induitur liberis Caesaribus Carino Numerianoque. 38,2: misso ad munimentum Gallia maiore filio. 39,12: is finis Caro liberisque, Narbone patria, imperio biennii fuere.
f) Hist. Aug. Car. 5,4: praef. praet. a Probo factus tantum sibi apud milites amoris locavit, ut interfecto Probo … dignissimus videretur imperio. 7,1: bellum Persicum … adgressus est, liberis Caesaribus nuncupatis, et ita quidem ut Carinum ad Gallias tuendas cum viris lectissimis destinaret, secum vero Numerianum, adulescentem … duceret.
g) Syncell. 472,10: Κᾶροϲ ἀνὴρ Γαλάτηϲ ἀνδρεῖοϲ. 472,20–2: ἦν δὲ τότε κατὰ τὴν Ῥώμην Καρῖνοϲ ὁ Κάρου παῖϲ ὑπὸ τοῦ πατρὸϲ ἐκεῖ καταλειφθείϲ, ἡνίκα ἐπὶ Πέρϲαϲ ἐϲτράτευϲε, χαλεπὸϲ τοῖϲ Ῥωμαίοιϲ φανείϲ. 472,24: τὸν δὲ Καρῖνον ἀδίκωϲ τῇ ἀρχῇ χρώμενον.
fr. 99
a) Eutr. 9,18,1: sed dum bellum adversus Sarmatas gerit, nuntiato Persarum tumultum ad Orientem profectus res contra Persas nobiles gessit. … Cochen et Ctesiphontem urbes nobilissimas cepit. et cum castra supra Tigridem haberet, vi divini fulminis periit.
b) Hier. chron. 224g: Carus … cum omni Parthorum regione vastata Cochem et Ctesifontem, nobilissimas hostium urbes, cepisset, super Tigridem castra ponens fulmini ictus interiit.
c) Ruf. Fest. 24,2: Cari imperatoris victoria de Persis nimium potens superno numina visa est. nam ad invidiam caelestis indignations pertinuisse credenda est. is enim ingressus Persidam quasi nullo obsistente vastavit, Cochen et Ctesiphontem, urbes Persarum nobilissimas, cepit. cum victor totius gentis castra supra Tigridem haberet, vi fulminis ictus interiit.
d) Aur. Vict. 38,2–4: in Mesopotamiam protinus pergit … ubi fusis hostibus, dum gloriae inconsulte avidior Ctesiphonta urbem Parthiae inclitam transgreditur, fulminis tactu conflagravit. id quidam iure ei accidisse referunt. nam cum oracula docuissent adusque oppidum memoratum perveniri victoria licere, longius delatus poenas luit.
f) Hist. Aug. Car. 8,1: ingenti apparatu et totis viribus Probi, profligato magna ex parte bello Sarmatico quod gerebat, contra Persas profectus, nullo sibi occurrente, Mesopotamiam Carus cepit et Ctesifontem usque pervenit. 8,7: his accessit quod cubiculari dolentes principis mortem incenderunt tentorium. unde subito fama emersit fulmine interemptum eum. 9,1: plerique dicunt vim fati quondam esse ut Romanus princeps Ctesifontem transire non possit, ideoque Carum fulmine absumptum quod eos fines transgredi cuperet qui fataliter constituti sunt.
g) Syncell. 472,10–3: τῷ β´ αὐτοῦ ἔτει Κᾶροϲ ἀνὴρ Γαλάτηϲ ἀνδρεῖοϲ ὑπάρχων ἐχειρώϲατο Ϲαρμάταϲ ἐπαναϲτάνταϲ. πολεμήϲαϲ δὲ καὶ Πέρϲαιϲ παρέλαβε Κτηϲιφῶντα ὃϲ παρὰ τῷ ποταμῷ Τίγριδι διαϲτρατοπεδευόμενοϲ κεραυνοῦ καταϲκήψαντοϲ ἀθρόωϲ ἅμα τῇ ϲκηνῇ διαφθείρεται.
g) Pol. Silv. princ. 54: Carus in Perside fulminatus.
fr. 100
a) Eutr. 9,18,2: Numerianus … cum oculorum dolore correptus in lecticula veheretur, inpulsore Apro, qui socer eius erat, per insidias occisus est. et cum dolo occultaretur ipsius mors, quousque Aper invadere posset imperium, foetore cadaveris prodita est. milites enim, qui eum sequebantur, putore commoti diductis lecticulae palliis post aliquot dies mortem eius notam habere potuerunt. 9,19,2: Diocletianum … Dalmatia oriundum … scribae filius … is (Diocletianus) prima militum contione iuravit Numerianum nullo suo dolo interfectum et, cum iuxta eum Aper, qui Numeriano insidias fecerat, constitisset, in conspectu exercitus manu Diocletiani gladio percussus est.
b) Hier. chron. 225a: Numerianus cum ab oculorum dolorem lecticula veheretur, insidiis Apri soceri sui occisus est vix faetore cadaveris post aliquot dies scelere comperto. 225c: Diocletianus Dalmata scribae filius imperator electus statim Aprum in militum contione percussit iurans sine suo scelere Numerianum interfectum.
d) Aur. Vict. 38,6 sq.: at Numerianus … Apri praefecti praetorio soceri insidiis extinguitur. quis casum detulit adolescentis oculorum dolor. 38,8: denique diu facinus occultatum, dum clausum lectica cadaver specie aegr⟨i, n⟩e vento obtunderetur acies, gestabatur. 39,1: sed pos-
tea odore tabescentium membrorum scelus proditum est, ducum consilio tribunorumque Valerius Diocletianus, domesticos regens, ob sapientiam deligitur. 39,13: igitur Valerius prima ad exercitum contione cum educto gladio solem intuens obtestaretur ignarum cladis Numeriani … Aprum proxime adstantem ictu transegit.
e) Epit. Caes. 38,4 sq.: Numerianus quoque, filius eius, cum oculorum dolore correptus in lecticula veheretur, impulsore Apro, qui socer eius erat, per insidias occisus est. cum dolo occultaretur ipsius mors, quousque Aper invadere posset imperium, foetore cadaveris scelus est proditum.
f) Hist. Aug. Car. 12,1: cum oculos dolere coepisset … ac lectica portaretur, factione Apri soceri sui … occisus est. 12,2: sed cum per plurimos dies de imperatoris salute quareretur a milite contionaretur Aper idcirco illum videri non posse quod oculos invalidos a vento ac sole subtraheret, foetore tamen cadaveris res esset prodita, omnes invaserunt Aprum … tunc habita est ingens contio, factum etiam tribunal. 13,1: Diocletianum omnes divino consensu … Augustum appellaverunt, domesticos tunc regentem. 13,2: hic cum tribunal conscendisset atque Augustus esset appellatus, et quareretur, quem ad modum Numerianus esset occisus, educto gladio Aprum … percussit.
g) Syncell. 472,14–18: μεθ’ ὃν ὁ Νουμεριανὸϲ υἱὸϲ αὐτοῦ βαϲιλεύει λ΄ μόναϲ ἡμέραϲ. ἐπανιὼν γὰρ ἐκ Περϲῶν καὶ ὀφθαλμιάϲαϲ ὑπὸ τοῦ ἰδίου πενθεροῦ φονεύεται, τὴν μὲν προϲηγορίαν Ἄπεροϲ, ἐξάρχου δὲ κατὰ τὸ ϲτρατόπεδον ὄντοϲ καὶ βαϲιλεῦϲαι ϲπουδάϲαντοϲ, πλὴν ἀλλὰ τῆϲ ἐλπίδοϲ ἀποτυχόντοϲ· ἡ ϲτρατεία γὰρ πᾶϲα Διοκλητιανὸν ἀνηγόρευϲε βαϲιλέα ϲυϲτρατευϲάμενον τῷ Κάρῳ τοτε. 472,22–24: Διοκλητιανὸϲ δὲ παραλαβὼν τὴν ἀρχὴν τὸν μὲν ὕπαρχον Ἄπερα τὸν τοῦ Νουμεριανοῦ ϲφαγέα παραχρῆμα φονεύει.
fr. 101
a) Eutr. 9,20,2: postea Carinum omnium odio et detestatione viventem apud Margum ingenti proelio vicit proditum ab exercitu suo, quem fortiorem habebat, certe desertum, inter Viminacium atque Aureum montem.
b) Hier. chron. 225b: Carinus proelio victus aput Margum occiditur.
d) Aur. Vict. 39,11: at Carinus ubi Moesiam contigit, ilico Margum iuxta Diocletiano congressus, dum victos avide premeret, suorum ictu interiit, quod libidine impatiens militarium multas affectabat, quarum infestiores viri iram tamen doloremque in eventum belli distulerant.
fr. 102
a) Eutr. 9,20,3: ita rerum Romanarum potitus, cum tumultum rusticani in Gallia concitassent et factioni suae Bacaudarum nomen inponerent, duces autem haberent Amandum et Aelianum, ad subigendos eos Maximianum Herculium Caesarem misit, qui levibus proeliis agrestes domuit et pacem Galliae reformavit.
b) Hier. chron. 225d: Diocletianus in consortium regni Herculium Maximianum adsumit. qui rusticorum multitudine oppressa, quae factioni suae Bacaudarum nomen indiderat, pacem Galliis reddidit.
d) Aur. Vict. 39,17–19: namque ubi comperit Carini discessu Aelianum Amandumque per Galliam excita manu agrestium ac latronum, quos Bagaudas incolae vocant, populatis late agris plerasque urbium temptare, statim Maximianum … imperatorem iubet. huic postea cultu numinis Herculium cognomentum accessit. … sed Herculius in Galliam profectus fusis hostibus aut acceptis quieta omnia brevi patraverat.
g) Pol. Silv. princ. 58: Diocletianus et Maximianus, sub quibus primum imperium Romanorum divisum est.
fr. 103
a) Eutr. 9,21: per haec tempora etiam Carausius, qui vilissime natus strenuae militiae ordine famam egregiam fuerat consecutus, cum apud Bononiam per tractum Belgicae et Armorici pacandum mare accepisset, quod Franci et Saxones infestabant, multis barbaris saepe captis nec praeda integra aut provincialibus reddita aut imperatoribus missa, cum suspicio esse coepisset consulto ab eo admitti barbaros, ut transeuntes cum praeda exciperet atque hac se occasione ditaret, a Maximiano iussus occidi, purpuram sumpsit et Britannias occupavit.
b) Hier. chron. 225e: Carausius sumpta purpura Brittanias occupavit.
d) Aur. Vict. 39,20 sq.: quo bello Carausius, Menapiae civis, factis promptioribus enituit. eoque eum, simul quia gubernandi (quo officio adolescentiam mercede exercuerat) gnarus habebatur, parandae classi ac propulsandis Germanis maria infestantibus praefecere. hoc elatior, cum barbarorum multos opprimeret neque praedae omnia in aerarium referret, Herculii metu, a quo se caedi iussum compererat, Britanniam hausto imperio capessivit.
fr. 104
a) Eutr. 9,22,1: ita cum per omnem orbem terrarum res turbatae essent, Carausius in Britanniis rebellaret, Achilleus in Aegypto, Africam Quinquegentiani infestarent, Narseus Orienti bellum inferret, Diocletianus Maximianum Herculium ex Caesare fecit Augustum, Constantium et Maximianum Caesares; quorum Constantius per filiam nepos Claudii traditur, Maximianus Galerius in Dacia haud longe a Serdica natus. atque ut eos etiam adfinitate coniungeret, Constantius privignam Herculii Theodoram accepit, ex qua postea sex liberos, Constantini fratres, habuit, Galerius filiam Diocletiani Valeriam, ambo uxores, quas habuerant, repudiare conpulsi.
b) Hier. chron. 225e: Narseus Orienti bellum intulit. 225f: Quinquegentiani Africam infestaverunt. 225g: Aegyptum Achilleus obtinuit. ob quae Constantius et Galerius Maximianus Caesares adsumuntur in regnum, quorum Constantius Claudii ex filia nepos fuit, Galerius in Dacia haut longe a Serdica natus. atque ut eos Diocletianus etiam adfinitate coniungeret, Constantius privignam Herculii Theodoram accepit, ex qua postea sex liberos, Constantini fratres habuit, Galerius filiam Diocletiani Valeriam, ambo uxores, quas habuerant, repudiare compulsi. 226e: Alexandria cum omni Aegypto per Achilleum ducem a Romana potestate desciscens.
d) Aur. Vict. 39,22–25: eodem tempore Orientem Persae, Africam Iulianus ac nationes Quinquegentanae graviter quatiebant. adhuc apud Aegypti Alexandriam Achilleus nomine dominationis insignia induerat. his de causis Iulium Constantium, Galerium Maximianum, cui cognomen Armentario erat, creatos Caesares in affinitatem vocant. prior Herculii
privignam, alter Diocletiano editam sortiuntur diremptis prioribus coniugiis, (ut in Nerone Tiberio ac Iulia filia Augustus quondam fecerat).
g) Origo Const. 1,1: Constantius, divi Claudii optimi principis nepos ex fratre. … iste cum Galerio a Diocletiano Caesar factus est. relicta enim Helena priore uxore, filiam Maximiani Theodoram duxit uxorem, ex qua postea sex liberos Constantini fratres habuit. … qui postea princeps potentissimus fuit.
fr. 105
a) Eutr. 9,22,2: cum Carausio tamen, cum bella frustra temptata essent contra virum rei militaris peritissimum, ad postremum pax convenit. eum post septennium Allectus socius eius occidit atque ipse post eum Britannias triennio tenuit. qui ductu Asclepiodoti praefecti praetorio oppressus est. ita Britanniae decimo anno receptae.
b) Hier. chron. 227a: post X annos per Asclepiodotum praefectum praetorio Britanniae receptae.
d) Aur. Vict. 39,39–42: solique Carausio remissum insulae imperium, postquam iussis ac munimento incolarum contra gentes bellicosas opportunior habitus. quem sane sexennio post Allectus nomine dolo circumvenit. qui cum eius permissu summae rei praeesset, flagitiorum et ob ea mortis formidine per scelus imperium extorserat. quo usum brevi Constantius Asclepiodoto, qui praetorianis praefectus praeerat, cum parte classis ac legionum praemisso delevit.
fr. 106
a) Eutr. 9,23: per idem tempus a Constantio Caesare in Gallia bene pugnatum est. circa Lingonas die una adversam et secundam fortunam expertus est. nam cum repente barbaris ingruentibus intra civitatem esset coactus tam praecipiti necessitate, ut clausis portis in murum funibus tolleretur, vix quinque horis mediis adventante exercitu sexaginta fere milia Alamannorum cecidit.
b) Hier. chron. 227b: iuxta Lingonas a Constantio Caesare LX milia Alamannorum caesa.
d) Aur. Vict. 39,43: et interea caesi Marcomanni.
fr. 107
a) Eutr. 9,23: Maximianus quoque Augustus bellum in Africa profligavit domitis Quinquegentianis et ad pacem redactis. Diocletianus obsessum Alexandriae Achilleum octavo fere mense superavit eumque interfecit. victoria acerbe usus est: totam Aegyptum gravibus proscriptionibus caedibusque foedavit.
b) Hier. chron. 226e: Alexandria … octavo obsidionis mense a Diocletiano capta est. itaque plurimi per totam Aegyptum gravibus proscriptionibus exiliisque vexati interfectis his, qui auctores perduellionis extiterant.
d) Aur. Vict. 39,38 sq.: at in Aegypto Achilleus facili negotio pulsus poenas luit. per Africam gestae res pari modo.
fr. 108
a) Eutr. 9,24: Galerius Maximianus primum adversus Narseum proelium insecundum habuit inter Callinicum Carrasque congressus, cum inconsulte magis quam ignave dimicasset; admodum enim parva manu cum copiosissimo hoste commisit. pulsus igitur et ad Diocletianum profectus, cum ei in itinere occurrisset, tanta insolentia a Diocletiano fertur exceptus, ut per aliquot passuum milia purpuratus tradatur ad vehiculum cucurrisse.
b) Hier. chron. 227c: Galerius Maximianus victus a Narseo ante carpentum Diocletiani purpuratus cucurrit.
c) Ruf. Fest. 25,1: Maximianus Caesar … pulsus recessit ac tanta a Diocletiano indignatione susceptus est, ut ante carpentum eius per aliquot milia passuum cucurrerit purpuratus.
d) Aur. Vict. 39,33 sq.: provincia credita Maximiano Caesari, uti relictis finibus in Mesopotamiam progrederetur ad arcendos Persarum impetus. a quis primo graviter vexatus.
g) Amm. 14,11,10: in Syria Augusti vehiculum irascentis per spatium mille passuum fere pedes antegressus est Galerius purpuratus.
fr. 109
a) Eutr. 9,25,1: mox tamen per Illyricum Moesiamque contractis copiis rursus cum Narseo Hormisdae et Saporis avo in Armenia maiore pugnavit successu ingenti nec minore consilio, simul fortitudine, quippe qui etiam speculatoris munus cum altero aut tertio equite susceperit. pulso Narseo castra eius diripuit; uxores, sorores, liberos cepit, infinitam extrinsecus Persarum nobilitatem, gazam Persicam copiosissimam.
b) Hier. chron. 227f: Galerius Maximianus superato Narseo et uxoribus ac liberis sororibus eius captis a Diocletiano ingenti honore suscipitur.
c) Ruf. Fest. 25,2 sq.: et cum vix impetrasset, ut reparato de limitaneis Daciae exercitu eventum Martis repeteret, in Armenia maiore ipse imperator cum duobus equitibus exploravit hostes, et cum viginti quinque milibus militum superveniens castris hostilibus subito innumera Persarum aggressus ad internicionem cedidit. rex Persarum Narseus effugit, uxor eius et filiae captae sunt.
d) Aur. Vict. 39,34 sq.: contracto confestim exercitu e veteranis ac tironibus per Armeniam in hostes contendit. quae ferme sola seu facilior vincendi via est. denique ibidem Narseum regem in dicionem subegit, simul liberos coniugesque et aulam regiam.
fr. 110
a) Eutr. 9,25,2: Carpis et Basternis subactis … quarum nationum ingentes captivorum copias in Romanis finibus locaverunt.
b) Hier. chron. 226b: Carporum et Basternorum gentes in Romanum solum translatae.
d) Aur. Vict. 39,43: Carporumque natio translata omnis in nostrum solum.
fr. 111
a) Eutr. 9,26: diligentissimus tamen et sollertissimus princeps et qui imperio Romano primus regiae consuetudinis formam magis quam Romanae libertatis invexerit … ornamenta gemmarum vestibus calciamentisque indidit.
b) Hier. chron. 226c: primus Diocletianus adorari se ut deum iussit et gemmas vestibus calciamentisque inseri cum ante eum omnes imperatores in modum iudicum salutarentur et chlamydem tantum purpuream a privato habitu plus haberent.
d) Aur. Vict. 39,1–4: magnus vir, his moribus tamen, quippe qui primus ex auro veste quaesita serici ac purpurae gemmarumque vim plantis concupiverit. quae quamquam plus quam civilia tumidique et affluentis animi, levia tamen prae ceteris. namque se primus omnium Caligulam post Domitianumque dominum palam dici passus et adorari se appellarique uti deum.
g) Amm. 15,5,18: Diocletianus … omnium primus … instituit adorari, cum semper antea ad similitudinem iudicum salutatos principes legerimus.
fr. 112
a) Eutr. 9,27,1: Herculius autem propalam ferus et incivilis ingenii asperitatem suam etiam vultus horrore significans. hic naturae suae indulgens Diocletiano in omnibus est severioribus consiliis obsecutus.
d) Aur. Vict. 39,17: Maximianum fidum amicitia quamquam semiagrestem, militiae tamen atque ingenio bonum imperatorem iubet.
fr. 113
a) Eutr. 9,27,1 sq.: cum tamen ingravescente aevo parum se idoneum Diocletianus moderando imperio esse sentiret, auctor Herculio fuit, ut in vitam privatam concederent et stationem tuendae rei publicae viridioribus iunioribusque mandarent. cui aegre collega obtemperavit. tamen uterque uno die privato habitu imperii insigne mutavit, Nicomediae
Diocletianus, Herculius Mediolani, post triumphum inclitum, quem Romae ex numerosis gentibus egerant pompa ferculorum inlustri, qua Narsei coniuges sororesque et liberi ante currum ducti sunt. 9,28: Diocletianus privatus in villa, quae haud procul a Salonis est, praeclaro otio senuit inusitata virtute usus, ut solus omnium post conditum Romanum imperium ex tanto fastigio sponte ad privatae vitae statum civilitatemque remearet. contigit igitur ei, quod nulli post natos homines, ut cum privatus obisset, inter divos tamen referretur.
b) Hier. chron. 227m: Diocletianus et Maximianus Augusti insigni pompa Romae triumpharunt antecedentibus currum eorum Narsei coniuge sororibus liberis et omni praeda, qua Parthos spoliaverant. 228d: secundo anno persecutionis Diocletianus Nicomediae, Maximianus Mediolanii purpuram deposuerunt. 230d: Diocletianus haut procul a Salonis in villae suae Palatio moritur et solus omnium inter deos privatus refertur.
d) Aur. Vict. 39,47 sq.: quo quidem plures volunt imperium posuisse. namque imminentium scrutator, ubi fato intestinas clades et quasi fragorem quendam impendere comperit status Romani, celebrato regni vicesimo anno valentior curam rei publicae abiecit, cum in sententiam Herculium aegerrime traduxisset, cui anno minus potentia fuerat. et quamquam aliis alia aestimantibus veri gratia corrupta sit, nobis tamen excellenti natura videtur ad communem vitam spreto ambitu descendisse.
g) Pol. Silv. princ. 58: (Diocletianus et Maximianus). hi primi sponte regnum deposuerunt.
fr. 114
a) Eutr. 10,2: Caesares duo creavit, Maximinum, quem Orienti praefecit, et Severum, cui Italiam dedit.
b) Hier. chron. 228f: Maximinus et Severus a Galerio Maximiano Caesares facti.
d) Aur. Vict. 40,1: Severus Maximinusque … Caesares, prior Italiam, posterior in quae Iovius obtinuerat destinantur.
fr. 115
a) Eutr. 10,1,3: obiit in Britannia Eboraci principatus anno tertio decimo. 10,2,2: Constantinus ex obscuriore matrimonio eius filius in Britannia creatus est imperator et in locum patris exoptatissimus moderator accessit.
b) Hier. chron. 228g: Constantius XVI imperii anno diem obit in Brittania Eboraci. post quem filius eius Constantinus ex concubina Helena procreatus regnum invadit.
d) Aur. Vict. 40,3 sq.: et forte iisdem diebus ibidem (sc. in Britannia) Constantium patrem vel parentem vitae ultima urgebant. quo mortuo cunctis, qui aderant, adnitentibus imperium capit.
g) Origo Const. 2,4: Constantius pater Eboraci mortuus est et Constantinus omnium militum consensu Caesar creatus.
fr. 116
a) Eutr. 10,2,3 sq.: Romae interea praetoriani excito tumultu Maxentium, Herculii filium, qui haud procul ab urbe in villa publica morabatur, Augustum nuncupaverunt. quo nuntio Maximianus Herculius ad spem arrectus resumendi fastigii, quod invitus amiserat, Romam advolavit e Lucania, quam sedem privatus elegerat in agris amoenissimis consenescens, Diocletianumque etiam per litteras adhortatus est, ut depositam resumeret potestatem, quas ille inritas habuit. sed adversum motum praetorianorum atque Maxentii Severus Caesar Romam missus a Galerio cum exercitu venit obsidensque urbem militum suorum scelere desertus est. auctae Maxentii opes confirmatumque imperium. Severus fugiens Ravennae interfectus est.
b) Hier. chron. 229a: Maxentius, Herculii Maximiani filius, a praetorianis militibus Romae Augustus appellatur. 229b: Severus Caesar a Galerio Maximiano contra Maxentium missus Ravennae interficitur.
d) Aur. Vict. 40,5–7: interim Romae vulgus turmaeque praetoriae Maxentium retractante diu patre Herculio imperatorem confirmant. quod ubi Armentarius accepit, Severum Caesarem, qui casu ad urbem erat, arma
in hostem propere ferre iubet. is circum muros cum ageret, desertus a suis, quos praemiorum illecebris Maxentius traduxerat, fugiens obsessusque Ravennae obiit.
fr. 117
a) Eutr. 10,3,2: inde ad Gallias profectus est dolo conposito, tamquam a filio esset expulsus, ut Constantino genero iungeretur, moliens tamen Constantinum reperta occasione interficere; … detectis igitur insidiis per Faustam filiam, quae dolum viro enuntiaverat, profugit Herculius Massiliaeque oppressus (ex ea enim navigare ad filium praeparabat) poenas dedit.
b) Hier. chron. 229d: Herculius Maximianus a filia Fausta detectus, quod dolum Constantino viro suo pararet, Massiliae fugiens occiditur.
d) Aur. Vict. 40,21 sq.: namque Herculius natura impotentior, simul filii segnitiem metuens inconsulte imperium repetiverat. cumque specie officii dolis compositis Constantinum generum tentaret acerbe, iure interierat.
e) Epit. Caes. 40,5: Maximianus Herculius a Constantino apud Massiliam obsessus, deinde captus, poenas dedit.
fr. 118
a) Eutr. 10,4,1: per hoc tempus a Galerio Licinius imperator est factus, Dacia oriundus, notus ei antiqua consuetudine et in bello, quod adversus Narseum gesserat, strenuus laboribus et officiis acceptus.
b) Hier. chron. 229c: Licinius a Galerio Carnunti imperator factus.
d) Aur. Vict. 40,8: hoc acrior Galerius ascito in consilium Iovio Licinium vetere cognitum amicitia Augustum creat.
fr. 119
a) Eutr. 10,4,3: bellum adversum Maxentium civile commovit, copias eius multis proeliis fudit, ipsum postremo Romae adversum nobiles omnibus exitiis saevientem apud pontem Mulvium vicit.
b) Hier 229k: Maxentius iuxta pontem Mulvium a Constantino superatus occiditur.
d) Aur. Vict. 40,16: (Constantinus) Maxentium petit. 40,20: flagrante per Italiam bello fusisque apud Veronam suis. 40,23: Maxentius atrocior in dies … insidiis, quas hosti apud pontem Milvium locaverat, … interceptus est.
fr. 120
a) Eutr. 10,4,4: non multo deinceps in Oriente quoque adversum Licinium Maximinus res novas molitus vicinum exitium fortuita apud Tarsum morte praevenit.
b) Hier. chron. 229h.: Maximinus … cum iam a Licinio puniendus esset, apud Tarsum moritur.
d) Aur. Vict. 41,1: cum haec in Italia geruntur, Maximinus ad Orientem … fusus fugatusque a Licinio apud Tarsum periit.
fr. 121
a) Eutr. 10,5: Licinio bellum intulit, quamquam necessitudo et adfinitas cum eo esset; nam soror Constantia nupta Licinio erat.
d) Aur. Vict. 41,2: ita potestas orbis Romani duobus quaesita, qui quamvis per Flavii sororem nuptam Licinio connexi inter se erant, … tamen anxie triennium congruere quivere.
fr. 122
a) Eutr. 10,6,1: varia deinceps inter eos bella et pax reconciliata ruptaque est.
d) Aur. Vict. 41,6: quo sane variis proeliis pulso. 41,8: itaque sexennio post rupta pace.
fr. 123
a) Eutr. 10,6,2: eo tempore res Romana sub uno Augusto et tribus Caesaribus, quod numquam alias, fuit.
d) Aur. Vict. 41,10: eo modo res publica unius arbitrio geri coepit liberis Caesarum nomina diversa retentantibus.
fr. 124
a) Eutr. 10,6,3: primum necessitudines persecutus egregium virum filium et sororis filium commodae indolis iuvenem interfecit, mox uxorem, post numerosos amicos.
b) Hier. chron. 231d: Crispus, filius Constantini, et Licinius iunior, Constantiae Constantini sororis et Licinii filius, crudelissime interficiuntur. 232a: Constantinus uxorem suam Faustam interficit.
d) Aur. Vict. 41,10: quorum cum natu grandior, incertum, qua causa, patris iudicio occidisset.
fr. 125
a) Eutr. 10,8,2 sq.: bellum adversus Parthos moliens, qui iam Mesopotamiam fatigabant, uno et tricesimo anno imperii, aetatis sexto et sexagesimo Nicomediae in villa publica obiit. denuntiata mors eius etiam per crinitam stellam, quae inusitatae magnitudinis aliquamdiu fulsit; eam Graeci cometen vocant.
b) Hier. chron. 234b: Constantinus cum bellum pararet in Persas in Acyrone villa publica iuxta Nicomediam moritur anno aetatis LXVI.
c) Ruf. Fest. 26,1: Constantinus … extremo vitae suae tempore expeditionem paravit in Persas.
d) Aur. Vict. 41,16: anno imperii tricesimo secundoque … sexaginta natus atque amplius duo, in Persas tendens … rure proximo Nicomediae, Achyronam vocant, excessit, cum id taetrum sidus regnis, quod crinitum vocant, portendisset.
fr. 126
a) Eutr. 10,9,1 sq.: verum Dalmatius Caesar prosperrima indole neque patruo absimilis haud multo post oppressus est factione militari {et} Constantio patrueli suo sinente potius quam iubente. Constantinum porro bellum fratri inferentem et apud Aquileiam inconsultius proelium adgressum Constantis duces interemerunt.
b) Hier. chron. 234e: Dalmatius Caesar quem patruus Constantinus consortem regni filiis dereliquerat, factione Constantii patruelis et tumultu militari interimitur. 235a: Constantinus bellum fratri inferens iuxta Aquileiam Alsae occiditur.
d) Aur. Vict. 41,22: igitur confestim Dalmatius, incertum quo suasore, interficitur. statimque triennio post minimum maximumque fatali bello Constantinus cadit.
fr. 127
a) Eutr. 10,9,3 sq.: Constantis imperium strenuum aliquamdiu et iustum fuit. mox, cum et valetudine inprospera et amicis pravioribus uteretur, ad gravia vitia conversus, cum intolerabilis provincialibus, militi iniucundus esset, factione Magnentii occisus est. obiit … anno imperii septimo decimo, aetatis tricesimo, rebus tamen plurimis strenue in militia gestis exercituique per omne vitae tempus sine gravi crudelitate terribilis.
d) Aur. Vict. 41,23: qua Constans victoria tumidior, simul per aetatem cautus parum atque animi vehemens, adhuc ministrorum pravitate exsecrabilis ac praeceps in avaritiam despectumque militarium, anno post triumphum decimo Magnentii scelere circumventus est externarum sane gentium compressis motibus.
g) Pol. Silv. princ. 65: Constans frater praedicti vitae infamissimae occisus.
fr. 128
a) Eutr. 10,10,2: quem grandaevum iam et cunctis amabilem diuturnitate et felicitate militiae ad tuendum Illyricum principem creaverunt, virum probum et morum veterum ac iucundae civilitatis, sed omnium liberalium artium expertem adeo, ut ne elementa quidem prima litterarum nisi grandaevus et iam imperator acceperit.
d) Aur. Vict. 41,26: tum quia Vetranio litterarum prorsus expers et ingenio stolidior idcircoque agresti vecordia pessimus, cum per Illyrios peditum magisterio milites curaret, dominationem ortus Moesiae superioris locis squalidioribus improbe occupaverat.
fr. 129
a) Eutr. 10,11,1: sed a Constantio … abrogatum est Vetranioni imperium; novo inusitatoque more consensu militum deponere insigne conpulsus.
b) Hier. chron. 238c: Vetranioni aput Naissum a Constantio regium insigne detractum.
d) Aur. Vict. 42,1: eum Constantius cis mensem decimum facundiae vi deiectum imperio in privatum otium removit.
fr. 130
a) Eutr. 10,11,2: Romae quoque tumultus fuit Nepotiano Constantini sororis filio per gladiatoriam manum imperium vindicante. qui saevis exordiis dignum exitum nanctus est. vicesimo enim atque octavo die a Magnentianis ducibus oppressus poenas dedit. caput eius pilo per urbem circumlatum est gravissimaeque proscriptiones et nobilium caedes fuerunt.
b) Hier. chron. 238b: Nepotiani caput pilo per urbem circumlatum multaeque proscriptiones nobilium et caedes factae.
d) Aur. Vict. 42,6–8: interim Romae corrupto vulgo, simul Magnentii odio Nepotianus materna stirpe Flavio propinquus caeso urbi praefecto armataque gladiatorum manu imperator fit. cuius stolidum ingenium adeo plebi Romanae patribusque exitio fuit, uti passim domus fora viae templaque cruore aut cadaveribus opplerentur bustorum modo, neque per eum tantum, verum etiam advolantibus Magnentianis, qui tricesimo die triduo minus hostem perculerant.
fr. 131
a) Eutr. 10,12,2: Orienti mox a Constantio Caesar est datus patrui filius Gallus Magnentiusque diversis proeliis victus vim vitae suae apud Lugdunum attulit imperii anno tertio, mense septimo, frater quoque eius Senonis, quem ad tuendas Gallias Caesarem miserat.
b) Hier. chron. 238e: Gallus, Constantii patruelis, Caesar factus. 238h: Magnentius Lugduni in Palatio propria se manu interficit et Decentius frater eius, quem ad tuendas Gallias Caesarem miserat, aput Senonas laqueo vitam explet.
d) Aur. Vict. 42,9 sq.: sed iam antea, cum externi motus suspectarentur, Magnentius fratri Decentio Gallias, Constantius Gallo, cuius nomen suo mutaverat, Orientem Caesaribus commiserant. ipsi inter se acrioribus proeliis per triennium congressi. ad extremum Constantius fugientem in Galliam persecutus vario ambos supplicio semet adegit interficere.
fr. 132
a) Eutr. 10,13: per haec tempora etiam a Constantio multis incivilibus gestis Gallus Caesar occisus est, vir natura ferus et ad tyrannidem pronior, si suo iure imperare licuisset. Silvanus quoque in Gallia res novas molitus ante diem tricesimum extinctus est solusque imperio Romano eo tempore Constantius princeps et Augustus fuit.
b) Hier. chron. 239c: Gallus Caesar (sollicitatus a Constantio patrueli, cui in suspicionem ob egregiam indolem venerat, Histriae) occiditur. 239d: Silvanus in Gallia res novas molitus XXVIII die extinctus est.
d) Aur. Vict. 42,12–16: neque multo post ob saevitiam atque animum trucem Gallus Augusti iussu interiit. ita longo intervallo annum fere post septuagesimum relata ad unum cura rei publicae. quae recens quieta a civili trepidatione Silvano in imperium coacto tentari rursus occeperat. is namque Silvanus, in Gallia ortus barbaris parentibus, ordine militiae, simul a Magnentio ad Constantium transgressu pedestre {ad} magisterium adolescentior meruerat. quo cum altius per metum seu dementiam conscendisset, legionum, a quis praesidium speraverat, tumultu octavum circa ac vicesimum diem trucidatus est.
e) Epit. Caes. 42,9–11: hoc tempore Gallus Caesar a Constantio occiditur; imperavit annos IIII. Silvanus imperator effectus die imperii vicesimo octavo perimitur. … quamquam barbaro patre genitus, tamen institutione Romana satis cultus et patiens.
fr. 133
a) Eutr. 10,14,1: mox Iulianum Caesarem ad Gallias misit … tradita ei in matrimonium sorore, cum multa oppida barbari expugnassent, alia obsiderent, ubique foeda vastitas esset … a quo modicis copiis apud Argentoratum, Galliae urbem, ingentes Alamannorum copiae extinctae sunt, rex nobilissimus captus, Galliae restitutae.
b) Hier. chron. 240g: magnae Alamannorum copiae aput Argentoratum oppidum Galliarum a Caesare Iuliano oppressae.
d) Aur. Vict. 42,17: Germanis pleraque earum partium populantibus, Iulianum Caesarem cognatione acceptum sibi Transalpinis praefecit.
Erklärung der Siglen, Zeichen und Abkürzungen in Text und Apparat
Erklärung der Zeichen in der Übersetzung
Abkürzungen
I. Standardwerke
AE
L’Année épigraphique
BHAC
Bonner Historia Augusta Colloquium
Chron. min.
Th. Mommsen (Hg.), Chronica minora saec. IV. V. VI. VII, 3 Bde. (= MGH AA 9. 11. 13) Berlin 1892–1898
CIL
Corpus Inscriptionum Latinarum
COD
Conciliorum Oecumenicorum Decreta, hg. von J. Wohlmuth, Paderborn3 2002
DNP
Der Neue Pauly
EIr
Encyclopedia Iranica
EKG
Enmannsche Kaisergeschichte
ERA
The Encyclopedia of the Roman Army, hg. von Y. Le Bohec, Chichester 2015.
FGrHist
Fragmente der griechischen Historiker
HAC
Historiae Augustae Colloquium
H.-Sz.
J. B. Hofmann / A. Szantyr, Lateinische Syntax und Stilistik (HdbAW 2,2,2) München 1965 (verbess. ND 1972)
HdbAW
Handbuch der Altertumswissenschaft
IG
Inscriptiones Graecae
ILS
Inscriptiones Latinae Selectae, hg. von H. Dessau
K.-H.
R. Kühner / F. Holzweissig, Ausführliche Grammatik der lateinischen Sprache, Erster Teil: Elementar-, Formen- und Wortlehre, Hannover 21912 (ND Darmstadt 1978)
K.-St.
R. Kühner / C. Stegmann, Ausführliche Grammatik der lateinischen Sprache, Zweiter Teil: Satzlehre 1/2, Hannover 21914 (mit Zusätzen und Berichtigungen zur 4. und 5. Aufl. von A. Thierfelder im ND Darmstadt 1997)
KFHist
Kleine und fragmentarische Historiker der Spätantike
Lampe
G. W. H. Lampe (ed.), A Patristic Greek Lexicon, Oxford 1961.
LIMC
Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae
MGHAA
Monumenta Germaniae Historica. Auctores antiquissimi
OLD
Oxford Latin Dictionary
PIR2
Prosopographia Imperii Romani (2. Auflage)
PLRE
Prosopography of the Later Roman Empire
RAC
Reallexikon für Antike und Christentum
RE
Paulys Real-Encyclopädie der classischen Altertumswissenschaft
RIC
Roman Imperial Coinage
Souter
A. Souter, A Glossary of Later Latin to 600 A. D., Oxford 1949
ThLL
Thesaurus Linguae Latinae
II. Quellen
Aetna = Ps-Vergilius, Aetna
W. V. Clausen et al., Appendix Vergiliana, Oxford 1966, 37–76.
Agath. = Agathias von Myrina
W. Seyfarth, Ammianus Marcellinus, Rerum gestarum libri qui supersunt, 2 Bde., Leipzig 1978
Amm. = Ammianus Marcellinus, Res gestae
R. Keydell (Hg.), Agathiae Myrinaei historiarum libri quinque (CFHB Series Berolinensis 2) Berlin u. a. 1967.
Ampel. = Ampelius, Liber memorialis
M.-P. Arnaud-Lindet, L. Ampelius. Aide-Mémoire (Liber memo-rialis), Paris 1993.
Anon. reb. bell. = Anonymus, De rebus bellicis
Ph. Fleury, De rebus bellicis. Sur les affaires militaires, Paris 2017.
Apul. met. = Apuleius, Metamorphosen
M. Zimmerman, Apulei Metamorphoseon Libri XI, Oxford 2012.
Arnob. nat. = Arnobius, Adversus nationes
C. Marchesi, Arnobius, Adversus nationes libri VII, Turin21953. H. Le Bonniec / B. Fragu / J. Champeaux / M. Armisen-Marchet-ti, Arnobe, Contre les Gentils, texte et traduction, 4 Bde., Paris 1982–2018
August. RG = Augustus, Res gestae
A. E. Cooley, Res gestae divi Augusti. Text, translation and commentary, Cambridge 2009.
Aur. Vict. = Aurelius Victor, Historiae abbreviatae
M. A. Nickbakht / C. Scardino, Aurelius Victor, Historiae abbre-viatae (KFHist B 3), Paderborn 2021.
Auson. grat. act. = Decimus Magnus Ausonius, Gratiarum actio
R. P. H. Green, Decimi Magni Avsonii opera, Oxford 1999, 161–80.
Cass. Dio = Cassius Dio
U. P. Boissevain, Cassii Dionis Cocceiani historiarum Roma-narum quae supersunt, 3 Bde., Berlin 1895–1901
Cassiod. chron. = Cassiodor, Chronica
Th. Mommsen, Cassiodorus, Chronica minora II (MGH AA 11), Berlin 1894, 109–61.
Cato agr. = M. Porcius Cato Censorius, De agri cultura
A. Mazzarino, De agri cultura: Ad fidem Florentini codicis de-perditi iteratis curis edidit, Leipzig 21982.
Chron. min. 1 = Chronica minora (Bd. 1)
Th. Mommsen, Chronica Minora, vol. 1 (MGH AA 9), Berlin 1892.
Chron. Pasch. = Chronicon Paschale
L. Dindorf, Chronicon Paschale, ad exemplar Vaticanum (CSHB 7), 2 Bde., Bonn 1832.
Claud. = Claudius Claudianus, Carmina
J. B. Hall, Claudius Claudianus, Carmina, Leipzig 1985.
J.-L. Charlet, Claudien, Œuvres 2, Poèmes politiques (395–398), texte établi et traduit, 2 Bde., Paris 2000
Cod. Theod. = Codex Theodosianus
Th. Mommsen / P. M. Meyer, Theodosiani libri XVI cum consti-tutionibus Sirmondianis et leges novellae ad Theodosianum pertinentes, 2 Bde., Berlin 1905.
Cons. Const. = Consularia Constantinopolitana (Descriptio consulum)
M. Becker / M. A. Nickbakht, in: Consularia Constantinopolita-na und verwandte Quellen (KFHist G 1–4), Paderborn 2016, 3–187.
Dig. = Digesten
P. Krüger / Th. Mommsen, Digesta Iustiniani Augusti, recognovit adsumpto in operis societatem, 2 Bde., Berlin 1868–70.
Epit. Caes. = Epitome de Caesaribus (Ps. Aurelius Victor)
F. Pichlmayr / R. Gruendel, Sexti Aurelii Victoris Liber de Cae-saribus, Leipzig 1970, 131–76.
M. Festy, Pseudo-Aurélius Victor, Abrégé des Césars, Paris 1999.
Epit. Carth. = Epitome Carthaginiensis
Th. Mommsen, Epitome Carthaginiensis, Chronica minora 1 (MGH AA 9), Berlin 1892, 493–97.
Eunap. vit. soph. = Eunapios, Vitae sophistarum
R. Goulet, Eunape de Sardes, Vie de philosophes et de sophistes, 2 Bde., Paris 2014.
M. Becker, Eunapios aus Sardes, Biographien über Philosophen und Sophisten, Wiesbaden 2013.
Eus. = Eusebius von Caesarea
chron. armen. = Chronik (in Armenisch)
Eusebius Werke, Fünfter Band, Die Chronik, aus dem Armeni-schen übers. von J. Karst (GCS 20) Berlin 1911.
h. e. = historia ecclesiastica (Kirchengeschichte)
E. Schwartz / Th. Mommsen (Hgg.), Eusebius, Werke II/1–3, Historia ecclesiastica (GCS 9,1–3), Leipzig 1903–9.
laus Const. = De laudibus Constantini (Tricennatsrede an Konstantin)
I. A. Heikel (Hg.), Eusebius, Werke I (GCS 7), Leipzig 1902, 193– 260
vit. Const. = vita Constantini
F. Winkelmann u. a. (Hgg.), Eusèbe de Césarée, Vie de Constantin, Paris 2013.
Eutr. = Eutropius, Breviarium
B. Bleckmann / J. Groß, Breviarium ab urbe condita, Paderborn 2018.
Flor. epit. = Florus, Epitome
H. Malcovati, L. Annaei Flori quae exstant, Rom 21972, 5–208.
Greg. M. epist. = Gregorius Magnus, registrum epistularum
D. Norberg, registrum epistularum (CCL 140; 140A), 2 Bde., Turnhout 1982.
Hdn. = Herodian
C. M. Lucarini, Herodianus, Regnum post Marcum, München 2005.
Hier. = Hieronymus
chron. = Chronik
R. Helm, Eusebius, Werke 7. Die Chronik des Hieronymus (GCS 47), Berlin 21956.
epist. = epistulae
I. Hilberg / M. Kamptner, Hieronymus, Epistulae 1–70 (CSEL 54), Wien 21996.
Hist. Aug. = Historia Augusta
E. Hohl u. a., Scriptores Historiae Augustae, Leipzig 5/21971.
E. Hohl, Historia Augusta. Römische Herrschergestalten, 2 Bde., Zürich 1985. (dt. Übersetzung)
J.-P. Callu u. a., Histoire Auguste, I,1. Introduction générale. Vies d’Hadrien, Aelius, Antonin, Paris 1992.
R. Turcan, Histoire Auguste, III,1. Vies de Macrin, Diadumé-nien, Héliogabale, Paris 1993.
C. Bertrand-Dagenbach / A. Molinier-Arbo, Histoire Auguste, III,2. Vie d’Alexandre Sévère, Paris 2014.
F. Paschoud, Histoire Auguste, IV,1. Vies des deux Maximins, des trois Gordiens, de Maxime et Balbin, Paris 2018.
O. Desbordes u. a., Histoire Auguste, IV,2. Vies des deux Valériens et des deux Galliens, Paris 2000.
F. Paschoud, Histoire Auguste. IV,3. Vies des Trente Tyrans et de Claude, Paris 2011.
F. Paschoud, Histoire Auguste, V,1. Vies d’Aurélien, Tacite, Paris 1996.
F. Paschoud, Histoire Auguste, V,2. Vies de Probus, Firmus, Sa-turnin, Proculus et Bonose, Carus, Numérien et Carin, Paris 2001.
Ioh. Ant. = Johannes Antiochenus
U. Roberto, Ioannis Antiocheni Fragmenta ex Historia chronica, Berlin 2005.
Ioh. Mal. = Johannes Malalas, Chronik
L. Dindorf, Ioannes Malalas, Chronographia (CSHB 26), Bonn 1831.
I. Thurn, Ioannis Malalae Chronographia, Berlin 2000.
Iord. Rom. = Jordanes, Romana
Th. Mommsen, Iordanes, Romana et Getica (MGH AA 5,1), Berlin 1882, 1–52.
Iul. = Iulianus imperator
ad Ath. = Epistula ad Athenienses
J. Bidez, L’empereur Julien. Oeuvres complètes, I,1. Discours de Julien César (I–V), Paris 1932.
caes. = Caesares
H.-G. Nesselrath, Iulianus Augustus Opera, Berlin 2015, 108–139.
mis. = Misopogon
H.-G. Nesselrath, Iulianus Augustus Opera, Berlin 2015, 174–213.
or. = Orationes
J. Bidez, L’empereur Julien. Oeuvres complètes, I,1. Discours de Julien César (I–V), Paris 1932.
Isid. orig. = Isidor von Sevilla, Origines (auch: Etymologiae)
W. M. Lindsay, Isidori Hispalensis episcopi etymologiarum sive originum, libri XX, 2 Bde., Oxford 1911.
Itin. Alex. = Itinerarium Alexandri
R. Tabacco, Itinerarium Alexandri, Turin 2000.
Iust. = Iustinus, Epitoma Historiarum Philippicarum Pompei Trogi
O. Seel, M. Iuniani Iustini epitoma Historiarum Philippicarum Pompei Trogi, Stuttgart 1985
Later. Veron. = Laterculus Veronensis
O. Seeck, Notitia dignitatum, Berlin 1876, 247–51.
Leo M. serm. = Papst Leo I., Sermones
A. Chavasse, Sancti Leonis Magni Romani Pontificis tractatvs septem et nonaginta, Bd. 2, Turnhout 1973.
Lib. or.= Libanios, Orationes
R. Foerster, Libanii opera, Orationes, 5 Bde., Leipzig 1903–8.
G. Fatouros / T. Krischer, Libanios, Antiochikos (or. XI), Wien 1992. (dt. Übersetzung)
Liv. perioch. = Livius perioche
P. Jal, Abrégés des livres de l’Histoire romaine de Tite-Live, XXXIV,2. "Periochae" transmises par les manuscrits (Periochae 70–142) et par le papyrus d’Oxyrhynchos, Paris 1984.
Lyd. = Joannes Lydus
mag. = De magistratibus populi Romani
J. Schamp, Jean le Lydien, Des magistratures de l’état romain, 3 Bde., Paris 2006.
mens. = De mensibus
R. Wuensch, Ioannis Lydi liber de mensibus, Leipzig 1898.
Mela = Pomponius Mela, Chorographia
A. Silberman, Pomponius Mela, Chorographie, Paris 1988.
Men. Rhet. = Menander Rhetor
D. A. Russel / N. G. Wilson, Menander Rhetor, Oxford 1981.
Nemes. cyn. = Nemesianus, Cynegetica
R. Jakobi, Nemesianus, Cynegetica. Edition und Kommentar, Berlin 2014.
Not. dign. occ. / or. = Notitia dignitatum
O. Seeck, Notitia Dignitatum, Berlin 1876, 1–225.
Origo Const. = Origo Constantini imperatoris (Anonymus Valesianus I)
I. König, Origo Constantini. Anonymus Valesianus, Teil 1: Text und Kommentar, Trier 1987.
Origo Rom. = Origo gentis Romanorum (Chronica Urbis Romae)
M. A. Nickbakht / M. Stein, in: Origo gentis Romanorum, Polemius Silvius etc. (KFHist B 5–7), Paderborn 2017, 3–140.
Oros. hist. = Orosius, Historiae adversum paganos
M.-P. Arnaud-Lindet, Orose: Histoires contre les païens, 3 Bde., Paris 1990–91.
Paneg. = Collectio panegyricorum Latinorum
R. A. B. Mynors, XII Panegyrici Latini, Oxford 1964.
Petr. Patr. = Petrus Patricius
C. Müller, Fragmenta Historicorum Graecorum, Vol. 4, Paris 1851, 181–99.
Philost. = Philostorgius, Historia ecclesiastica
B. Bleckmann / M. Stein, Philostorgios, Kirchengeschichte (KFHist E 7), 2 Bde., Paderborn 2015.
Plin. nat. = Plinius maior, Naturalis histori
L. v. Jan / K. Mayhoff, C. Plinius Caecilius Secundus, Naturalis historiae libri XXXVII, 6 Bde., Leipzig 1892–1909.
Pol. Silv. princ. = Polemius Silvius, Nomina omnium principum Romanorum
B. Bleckmann / I.-Y. Song, in: Origo gentis Romanorum Polemius Silvius etc. (KFHist B 5–7), Paderborn 2017, 188–97.
Prob. inst. gramm. = Marcus Valerius Probus, Instituta artium
H. Keil (Hg.), Grammatici latini, vol. 4, Leipzig 1864, 47–192.
Ruf. Fest. = Rufius Festus, Breviarium
S. Riessinger, De viris illustribus, additus Sextus Rufus, De historia Romana, Rom (oder Neapel?) 1468 (oder 1470).
F. Campanus, Plutarchus: Vitae illustrium virorum; Sextus Ru-fus: De historia Romana, Rom 1470, 559v–63r.
A. Tiphernas, Sexti Ruffi, De historia Romana libellus, Venedig 1474.
I. Camers, Lucii Flori de gestis Romanorum, Sexti Ruffi viri consularis de historia Romana epitome, Wien 1518, 105–15.
J. Cuspinianus, De consulibus Romanorum commentarij ex op-timis vetustissimisque authoribus collecti; praefertur his com-mentariis Sexti Ruffi v. consularis rerum gestarum populi Romani, Frankfurt 1553, 1–47.
J. Otho, Introductio in historiam Romanam; addidimus Sex. Rufi Breviarium rerum gestarum populi Romani, Brügge 1565, 81–111
F. Sylburg, Historiae Romanae scriptores Latini minores I, Frankfurt 1588, 548–56.
P. Pithou, Rufi Festi v. c. Breviarium rerum gestarum populi Ro-mani, Antwerpen 1602.
M. Z. Boxhorn, Historiae Augustae Scriptorum Latinorum mino-rum II, Leiden 1632, 662–687.
H. Verheyk, Sexti Rufi Festi Breviarium rerum gestarum populi Romani, Leipzig 1762.
W. Förster, Rufi Festi Breviarium rerum gestarum p. R., praemit-titur Dissertatio de Rufi Breviario eiusque codicibus, Wien 1874.
C. Wagener, Festi breviarium rerum gestarum populi Romani, Leipzig / Prag 1886.
J. W. Eadie, The Breviarium of Festus. A critical edition with historical commentary, London 1967.
M.-P. Arnaud-Lindet, Festus, Abrégé des hauts faits du peuple romain, texte établi et traduit par (CUF), Paris 1994 (ND 2002).
N. Zugravu, Festus: Breviarium rerum gestarum populi Romani, Iași 2003.
G. Kelly, The Breviarium of Festus, 2007
M. L. Fele, Il breviarium di Rufio Festo, testo, trad. e comm. fi-lologico con una introd. sullʼautore e lʼopera, Hildesheim 2009.
S. Costa, Rufio Festo, Breviario di storia Romana, testo latino a fronte, Mailand 2016.
A. Bettenworth / P. Schenk, Rufius Festus. Kleine Geschichte des römischen Volkes, Lateinisch-deutsch, Berlin 2020.
ŠKZ = Inschrift Schapurs an der Kaba Sartoscht (Res gestae Saporis)
Ph. Huyse, Die dreisprachige Inschrift Šābuhrs I. an der Kaʿba-i Zardušt (ŠKZ), 2 Bde., London 1999
Socr. = Socrates, Historia ecclesiastica
G. Ch. Hansen, Sokrates, Kirchengeschichte (GCS N.F. 1), Berlin 1995.
Soz. = Sozomenus, Historia ecclesiastica
G. Ch. Hansen, Sozomenos, Historia ecclesiastica – Kirchenge-schichte (FC 73/1–4), griechisch-deutsch, Turnhout 2004.
Suet. = Suetonius, De vita Caesarum libri
R. A. Kaster, C. Suetoni Tranquilli De vita Caesarum libros VIII et De grammaticis et rhetoribus librum, Oxford 2016.
M. Ihm, De vita Caesarum, Stuttgart 1908.
Symm. or. = Symmachus, orationes
A. Pabst, Quintus Aurelius Symmachus, Reden, Darmstadt 1989.
Syncell. = Synkellos, Chronographia
A. A. Mosshammer, Georgii Syncelli ecloga chronographica, Leipzig 1984.
Tab. Peut. = Tabula Peutingeriana
M. Rathmann (Hg.), Tabula Peutingeriana, Darmstadt 32018.
Tert. = Q. Septimius Florens Tertullianus
apol. = Apologeticum
E. Dekkers, Quinti Septimii Florentis Tertulliani Opera, vol. 1 (CCL 1), Turnhout 1954, 85–171.
orat. = De oratione
G. F. Diercks, Quinti Septimii Florentis Tertulliani Opera, vol. 1 (CCL 1), 1954, 257–274.
Them. or. = Themistios, Orationes
H. Schenkl / G. Downey, Themistii orationes quae supersunt, vol. 1, Leipzig 1965.
S. Swain, Themistius and Valens, Orations 6–13 (transl., annot. introd.), Liverpool 2021.
Theophn. = Theophanes Confessor, Chronik
C. de Boor, Theophanes, Chronographia, 2 Bde., Leipzig 1883–85 (ND Hildesheim 1963).
C. Mango / R. Scott, The Chronicle of Theophanes Confessor. Byzantine and Near Eastern History, A.D. 284–813, Oxford 1997.
Veg. mil. = Vegetius, Epitoma rei militaris
M. D. Reeve, Vegetius, Epitoma Rei Militaris, Oxford 2004.
Vir. ill. = Pseudo-Aurelius Victor, De viris illustribus
J. Fugmann (Hg.), Ps. Aurelius Victor, De viris illustribus urbis Romae. Die berühmten Männer der Stadt Rom, lat. und dt., Darmstadt 2016.
Vitr. = Vitruvius, De architectura
P. Fleury / L. Cabellat / P. Gros / C. Saliou / M. Zuinghedau / J. Soubiran, Vitruve, De l’architecture (CUF), 10 Bde., Paris 1969–2009.
Zonar. = Zonaras
L. Dindorf, Ioannis Zonarae Epitome historiarum, vol. 3, Leip-zig 1870.
Th. Büttner-Wobst, Ioannis Zonarae Epitomae historiarum libri XIII–XVIII (CSHB 31), Bonn 1897.
Zos. = Zosimus, Historia nea
F. Paschoud, Zosime, Histoire Nouvelle, 5 Bde., Paris 21979–2003.
III. Literatur
V. Aiello, La Pars Constantiniana degli Excerpta Valesiana. Intro-duzione, testo e commento storico, Messina 22014.
F. Alidoust, Natio molestissima. Römerzeitliche Perserbilder von Cicero bis Ammianus Marcellinus, Gutenberg 2018.
K. Altmayer, Die Herrschaft des Carus, Carinus und Numerianus als Vorläufer der Tetrarchie, Stuttgart 2014.
M. Antiqueira, Festus the Epitomator? The “Historical Monograph” of Festus, in: O. Devillers / B. B. Sebastiani (Hgg.), Sources et modèles des historiens anciens, Bordeaux 2018, 295–305.
B. Baldwin, Festus the Historian, Historia 27 (1978) 197–217.
T. D. Barnes, Jerome and the Origo Constantini, Phoenix 43 (1989) 158–161.
T. D. Barnes, The Lost Kaisergeschichte and the Latin Historical Tra-dition, Bonner Historia Augusta Colloquium 1968/1969, Bonn 1970, 13–43.
T. D. Barnes, The Sources of the „Historia Augusta“, Brüssel 1978.
T. D. Barnes, Rez. zu Eadie, JRS 58 (1968) 263–65.
S.-P. Bergjan / S. Elm (Hgg.), Antioch II. The many faces of Antioch: Intellectual exchange and religious diversity, CE 350–450, Tübingen 2018.
Bertrand-Dagenbach, Vie d’Alexandre Sévère s. unter Hist. Aug.
Bettenworth / Schenk, Rufius Festus s. unter Ruf. Fest.
H. W. Bird, The Breviarium ab urbe condita of Eutropius, Liverpool 1993.
H. W. Bird, Eutropius and Festus: Some reflections on the empire and imperial policy in A. D. 369/370, Florilegium 8 (1986) 11–22.
H. W. Bird, A Strange Aggregate of Errors for A. D. 193, CB 65 (1989) 95–8.
A. Birley, Further notes on HA Severus, in: G. Bonamente / F. Paschoud (Hgg.), Historiae Augustae Colloquium Genevense, Bari 1994, 19–42.
A. Birley, Septimius Severus. The African Emperor, London 21999.
B. Bleckmann, Überlegungen zur Enmannschen Kaisergeschichte und zur Formung historischer Traditionen in tetrarchischer und konstantinischer Zeit, in: G. Bonamente / K. Rosen (Hgg.), Historiae Augustae Colloquium Bonnense, Bari 1997, 11–37.
J. Bleicken, Augustus. Eine Biographie, Berlin 1998.
W. den Boer, Some Minor Roman Historians, Leiden 1972
J. den Boeft u. a., Philological and Historical Commentary on Ammianus Marcellinus, 9 Bde., Leiden 1998–2018.
M. F. A. Brok, Rez. zu Eadie, Mnemosyne 23,3 (1970) 322–24.
R. W. Burgess, A Common Source for Jerome, Eutropius, Festus, Am-mianus, and the Epitome de Caesaribus between 358 and 378, along with further thoughts on the date and nature of the Kaisergeschichte, CPh 100 (2005) 166–92.
R. W. Burgess, Jerome and the Kaisergeschichte, Historia 44 (1995) 349–369.
R. W. Burgess, On the Date of the Kaisergeschichte, CPh 90 (1995) 111–128.
R. W. Burgess, Principes cum tyrannis: Two Studies on the Kaisergeschichte and its Tradition, CQ 43 (1993) 491–500.
A. Cameron, The Last Pagans of Rome, New York 2011.
A. Cameron, Rez. zu Eadie, CR 19,3 (1969) 305–307.
A. Cappelli, Lexicon abbreviaturarum: Wörterbuch lateinischer und italienischer Abkürzungen, Leipzig 21928.
A. Chastagnol, Histoire Auguste. Les empereurs romains des IIe et IIIe siècles, Paris 1994.
A. Chastagnol, L’utilisation des “Caesares” d’Aurélius Victor dans l’Histoire Auguste, Bonner Historia Augusta Colloquium 1966/1967, Bonn 1968, 53–65.
F. Chausson, Severus, XVII,5–XIX,4: une identification?, in: G. Bonamente (Hg.), Historiae Augustae Colloquium Bonnense (1994), Bari 1997, 97–113.
A. Chauvot, Opinions romaines face aux barbares au IVe siècle ap. J.-C., Paris 1998.
E. Cizek, La poètique de l’histoire dans les abrégés du IVe siècle ap. J.-C., RPh 68,1 (1994) 107–29.
G. M. Cohen, The Hellenistic settlements in the East from Armenia and Mesopotamia to Bactria and India, Berkeley 2013
A. Cohn, Quibus ex fontibus S. Aurelii Victoris et libri de Caesaribus et epitomes undecim capita priora fluxerint, Leipzig 1884.
A. E. Cooley, Res Gestae Divi Augusti s. unter August. RG.
H. Dessau, Über Zeit und Persönlichkeit der Scriptores Historiae Au-gustae, Hermes 24 (1889) 337–92.
J. W. Drijvers, The forgotten reign of the emperor Jovian (363–364), Oxford 2022.
J. W. Eadie, The Breviarium of Festus: A fragment in Copenhagen, BICS 14 (1967) 93–5.
P. Edwell, Rome and Persia at war: Imperial competition and contact, Abingdon 2021.
S. Elm, Death and the Tigris: Does Later Roman Historiography present an Antiochene agenda? (Eutropius and Festus), in: Bergjan / Elm, Antioch II., 163–89.
K. Ehling / G. Weber (Hgg.), Konstantin der Grosse. Zwischen Sol und Christus, Darmstadt 2011.
A. Enmann, Eine verlorene Geschichte der römischen Kaiser und das Buch De viris illustribus urbis Romae. Quellenstudien, Philologus Suppl. 4 (1884) 337–501 (erschienen 1883).
Fele, Breviarium, s. unterRuf. Fest.
M. L. Fele, Le clausole del Breviarium di Festo, Hildesheim 1996.
Fleury, De rebus bellicis, s. unterAnon. Reb. Bell.
W. Förster, Die Escorialhandschrift des Breviarium Rufi Festi, WS 1 (1879) 303–9.
P. François, Rez. zu Arnaud-Lindet, Latomus 55,2 (1996) 415–18.
J. Fündling, Kommentar zur Historia Augusta. Vita Hadriani, 2 Bde., Bonn 2006.
F. Gasti, La letteratura tardolatina. Un profilo storico (secoli III–VII d.C.), Rom 2020.
R. Ghirshman, Iran. Parther und Sasaniden, München 1962.
T. Glas, Valerian. Kaisertum und Reformansätze in der Krisenphase des Römischen Reiches, Paderborn 2014.
T. Gnoli, Aureliano nel IV secolo, in: ders., Aspetti di Tarda Antichità. Storici, storia e documenti del IV secolo d. C., Bologna 2019.
A. Goltz / U. Hartmann, Valerianus und Gallienus, in: Johne, Die Zeit der Soldatenkaiser, Bd. 1, 223–95.
A. Goltz / H. Schlange-Schöningen (Hgg.), Das Zeitalter Diokletians und Konstantins. Bilanz und Perspektiven der Forschung, Köln 2022.
Goulet, Eunape de Sardes s. unter Eunap.
S. Grote, Another look at the Breviarium of Festus, CQ 61 (2011) 704–21.
K. Harper, Pandemics and Passages to Late Antiquity: Rethinking the Plague of c. 249–70, JRA 28 (2015) 223–60.
W. Hartke, De saeculi quarti exeuntis historiarum scriptoribus quaestiones, Leipzig 1932.
U. Hartmann, Der spätantike Philosoph. Die Lebenswelten der paganen Gelehrten und ihre hagiographische Ausgestaltung, 3 Bde., Bonn 2018.
U. Hartmann, Das palmyrenische Teilreich, in: Johne, Die Zeit der Soldatenkaiser, Bd. 1, 343–78.
U. Hartmann, Die Ziele der Orientpolitik Trajans, in: R. Rollinger et al. (Hgg.), Interkulturalität in der Alten Welt, Wiesbaden 2010, 591–633.
S. R. Hauser, Art. Seleukeia-Ktesiphon RAC 30 (2021) 234–51.
R. Helm, Hieronymus und Eutrop, RhM 76 (1927) 138–70 und 254–306.
E. Herkommer, Die Topoi in den Proömien der römischen Geschichtswerke, Diss. Tübingen 1968.
E. Hohl, Die Historia Augusta und die Caesares des Aurelius Victor, Historia 4 (1955) 220–228.
B. Isaac, The meaning of the terms limes and limitanei in ancient sources, in: ders., The Near East under Roman rule, Leiden 1998, 345–87 (= JRS 78 [1988] 125–47.
K.-P. Johne (Hg.), Die Zeit der Soldatenkaiser. Krise und Transformation des Römischen Reiches im 3. Jahrhundert n. Chr. (235–284), Berlin 2008.
A. H. M. Jones, The Later Roman Empire, London 1964.
G. Kelly, Ammianus, Valens, and Antioch, in: Bergjan / Elm, Antioch II., 137–62.
G. Kelly, The Roman World of Festus’ Breviarium, in: C. Kelly u. a. (Hgg.), Unclassical traditions. Volume I: Alternatives to the classical past in Late Antiquity, Oxford 2010, 72–89.
D. Kienast / W. Eck / M. Heil, Römische Kaisertabelle. Grundzüge einer römischen Kaiserchronologie, Darmstadt 62017.
S. Kiss, Schéma narratif et subjectivité du narrateur chez quelques his-toriens de l’Antiquité tardive, Pallas 102 (2016) 255–63.
Ch. Körner, Philippus Arabs. Ein Soldatenkaiser in der Tradition des antoninisch-severischen Prinzipats, Berlin 2002.
A. Kühnen, Die Imitatio Alexandri in der römischen Politik, Münster 2008.
B. Leadbetter, Galerius and the will of Diocletian, London 2009.
N. Lenski, Failure of Empire. Valens and the Roman State in the Fourth Century A.D., Berkeley 2002.
C. Lerouge, L’image des Parthes dans le monde gréco-romain, Stuttgart 2007.
C. S. Lightfoot, Trajan’s Parthian War and the Fourth Century Perspective, JRS 80 (1990) 115–26.
B. Löfstedt, Zum Gebrauch der lateinischen distributiven Zahlwörter, Eranos 56 (1958) 71–117 und 188–223.
F. K. Maier, Palastrevolution. Der Weg zum hauptstädtischen Kaisertum im Römischen Reich des vierten Jahrhunderts, Paderborn 2019.
Mango / Scott s. unter Thphn.
B. Manuwald, Das Gallische Sonderreich in literarischen Quellen, in: Th. Fischer (Hg.), Die Krise des 3. Jahrhunderts n. Chr. und das Gallische Sonderreich, Wiesbaden 2012, 13–27.
M. Marciak, Sophene, Gordyene, and Adiabene. Three Regna Minora of Northern Mesopotamia Between East and West, Leiden 2017.
G. Marconi, Rez. zu Fele, Rivista di cultura classica e medioevale 52,2 (2010) 423–5.
M. McCormick, Eternal victory. Triumphal rulership in late antiquity, Byzantium, and the early medieval West, Cambridge 1986.
N. McLynn, The Persian expedition, in: Rebenich / Wiemer, A companion to Julian the Apostate, 293–325.
M. Meier, Art. Seuche, RAC 30 (2021), 421–56.
Ch. Michels, Antoninus Pius und die Rollenbilder des römischen Prin-ceps. Herrscherliches Handeln und seine Repräsentation in der Hohen Kaiserzeit, Berlin 2018.
A. Momigliano, Pagan and Christian historiography in the fourth century A.D., in: Ders. (Hg.), The Conflict between Paganism and Christianity, Oxford 1963, 79–99.
Th. Mommsen, Über die Quellen der Chronik des Hieronymus, Ge-sammelte Schriften Bd. 7, Berlin 1909, 606–32.
I. Moreno Ferrero, Estructuras narrativas y léxico en el Breviario de Festo: las partículas, in: C. Codoñer u. a. (Hgg.) Stephanion: Homenaje a M. C. Giner, Salamanca 1988, 233–40.
K. Mosig-Walburg, Römer und Perser. Vom 3. Jahrhundert bis zum Jahr 363 n.Chr., Gutenberg 2009.
B. Mouchová, Das Breviarium des Festus und seine Adressaten, Graeco-Latina Brunensia 14 (2009) 143–56.
V. Neri, Medius princeps. Storia e immagine di Costantino nella storio-grafia latina pagana, Bologna 1992.
Nickbakht, Einleitung, s. unter Aur. Vict.
A. Pabst, Quintus Aurelius Symmachus, Reden, Darmstadt 1989.
F. Paschoud, Chronique d’historiographie tardive, AnTard 18 (2010) 309–320.
Paschoud, Zosime s. unterZos.
M. Peachin, The purpose of Festus’ Breviarium, Mnemosyne 38 (1985) 158–61.
H. Peter, Die geschichtliche Litteratur über die römische Kaiserzeit bis Theodosius I., Bd. 2, Leipzig 1897.
G. Pfund, Von Picus bis Licinius. Historischer Kommentar zu den Chronica urbis Romae im Chronographen von 354, Stuttgart 2021.
A. Piras, Rez. zu Fele, Latomus 70,3 (2011) 885 f.
W. Portmann, Die 59. Rede des Libanios und das Datum der Schlacht von Singara, ByzZ 82 (1989) 1–18.
M. Raimondi, Il Breviarium di Festo e il funzionariato cappadoce alla corte di Valente, Historia 55,2 (2006) 191–206.
S. Rebenich / H.-U. Wiemer (Hgg.), A Companion to Julian the Apostate, Leiden 2020.
M. D. Reeve, Rez. zu Arnaud-Lindet, Gnomon 69 (1997) 508–13.
D. Rohrbacher, The Historians of Late Antiquity, London 2002.
D. Rohrbacher, Enmann’s „Kaisergeschichte“ from Augustus to Domitian, Latomus 68 (2009) 709–19.
F. von Saldern, Studien zur Politik des Commodus, Rahden/Westf. 2003.
M. Schanz / C. Hosius (Hgg.), Festus, in: Die Litteratur des vierten Jahrhunderts (= HdbAW 8.4.1), München 21914, 82–4.
J. Schulde, Rome, Parthia, and the politics of peace, London 2020.
J. Schlumberger, Die Epitome de Caesaribus. Untersuchungen zur heidnischen Geschichtsschreibung des 4. Jahrhunderts, München 1974.
W. Schmid, Eutropspuren in der Historia Augusta. Ein Beitrag zum Problem der Datierung der Historia Augusta, Bonner Historia Augusta Colloquium 1963, Bonn 1964, 123–33.
P. L. Schmidt, Eusebius von Nantes (von Myndos?), in: J.-D. Berger u. a., Die Literatur im Zeitalter des Theodosius (374–430 n. Chr.). Erster Teil (HdbAW 8.6.1), München 2020, 623–43.
P. L. Schmidt, Eutropius, in: R. Herzog (Hg.): Restauration und Erneu-erung. Die lateinische Literatur von 284 bis 374 n. Chr. (= HdbAW 8.5), München 1989, 207–10.
P. L. Schmidt, Rufius Festus, in: R. Herzog (Hg.): Restauration und Er-neuerung. Die lateinische Literatur von 284 bis 374 n. Chr. (= HdbAW 8.5), München 1989, 201–7.
M. Sehlmeyer, Geschichtsbilder für Pagane und Christen. Res Romanae in den spätantiken Breviarien, Berlin 2009.
K. Strobel, Kaiser Traian. Eine Epoche der Weltgeschichte, Regensburg 22019.
I. Schön, Die spätlateinischen Kurzbiographien von Augustus bis Domitian und die sogenannte Enmannsche Kaisergeschichte, Diss. Berlin 1953.
J. B. Solodow, Raucae, tua cura, palumbes, Study of a Poetic Word Order, HSCPh 90 (1986) 129–53.
Swain, Themistius and Valens s. unter Themist.
D. Sperber, Calculo–Logistes–Ḥashban, CQ 19,2 (1969) 374–8.
W. Suerbaum, Vom Antiken zum Frühmittelalterlichen Staatsbegriff. Über Verwendung und Bedeutung von res publica, regnum, imperium und status von Cicero bis Jordanes, Münster 31977.
R. Syme, Emperors and Biography. Studies in the Historia Augusta, Oxford 1971.
L. Van Hoof / P. Van Nuffelen, The Fragmentary Latin Histories of Late Antiquity (AD 300–620). Edition, Translation and Commentary, Cambridge 2020.
M. Verweij, The Festus Manuscript in Brussels: Adventures and errors concerning MS 4659 of the Royal Library of Belgium, In Monte Artium 12 (2019) 121–40.
C. Wagener, Eutropius, Philologus 45 (1886) 509–51.
J. Wienand (Hg.), Contested Monarchy. Integrating the Roman Empire in the Fourth Century AD, Oxford 2015.
M. Winterbottom, Rez. zu Arnaud-Lindet, CR 45 (1995) 264 f.
E. Wölfflin, Das Breviarium des Festus, Archiv für Lateinische Lexi-kographie und Grammatik 13 (1904) 69–97 und 173–80.
G. Zecchini, Qualche ulteriore riflessione su Eusebio di Nantes e sull’EKG (1999), in: ders., Ricerche di storiografia latina tardoantica II. Dall’ Historia Augusta a Paolo Diacono, Rom 2011, 59–71.
S. Zinsli, Kommentar zur Vita Heliogabali der Historia Augusta, Bonn 2014.

